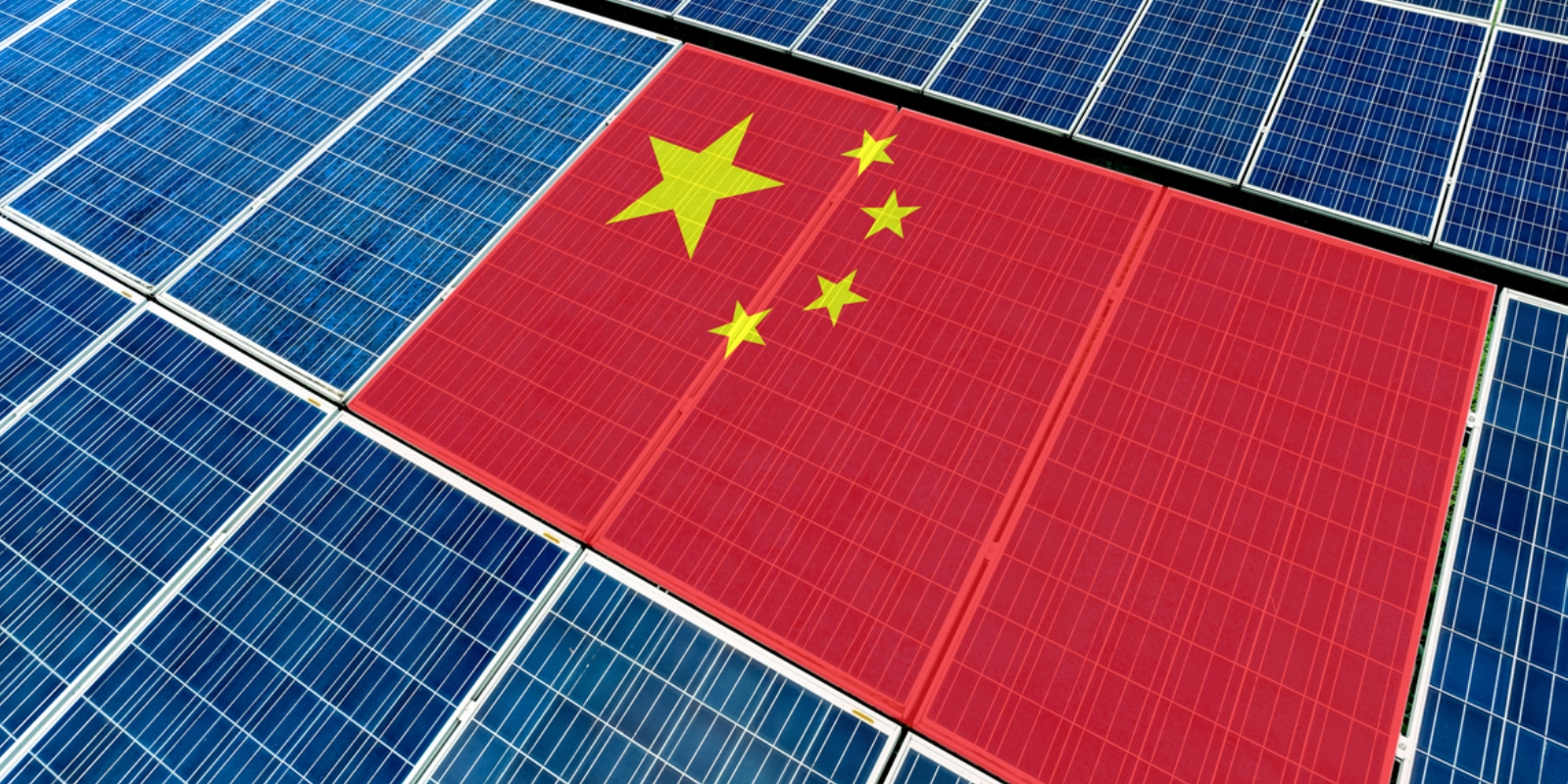Finanzlexikon Illusion der Vorhersagbarkeit
Warum Finanzprognosen oft scheitern.
In einer Welt, die von Unsicherheiten geprägt ist, bietet eine Prognose Halt. Ob Wachstum, Inflation, Aktienkurse oder Zinsschritte – fast täglich erscheinen neue Vorhersagen, die Orientierung versprechen. Banken, Ratingagenturen, Zentralbanken, Medien und Investmenthäuser liefern regelrechte Fluten an Einschätzungen. Anleger greifen gerne zu. Schließlich beruhigt es, wenn ein vermeintlicher Experte sagt, wohin der DAX bis Jahresende läuft oder wann der nächste Abschwung kommt.
Doch je genauer man hinsieht, desto klarer wird: Die Trefferquote ist ernüchternd. Nicht selten entwickeln sich Märkte völlig anders als vorhergesagt. Und doch hört niemand auf zu prognostizieren – und kaum jemand auf, diesen Prognosen Bedeutung beizumessen.
Warum Vorhersagen in komplexen Systemen scheitern
Prognosen werden bleiben – und das ist auch gut so, solange man sie richtig einordnet. Sie sind nicht Wahrheit, sondern Perspektive. Wer sie als Denkanstoß nutzt, als Möglichkeit, Szenarien zu entwickeln und Handlungsoptionen zu prüfen, der kann von ihnen profitieren."
Finanzmärkte sind keine Uhrwerke, sondern komplexe, dynamische Gebilde. Sie bestehen aus Millionen von Teilnehmern mit unterschiedlichem Wissen, verschiedenen Interessen und emotionalen Reaktionen. Wer hier eine treffsichere Prognose abgeben will, müsste nicht nur ökonomische Variablen exakt modellieren, sondern auch menschliches Verhalten antizipieren. Das gelingt nur selten – und wenn, dann eher durch Zufall als durch System.
Hinzu kommt: Prognosen basieren auf Modellen, und Modelle arbeiten mit Annahmen. Diese Annahmen sind nie vollständig. Sobald sich ein Rahmenparameter – etwa ein politisches Ereignis, ein Krieg, eine Pandemie oder eine technologische Disruption – ändert, wird die ganze Berechnung wertlos. Die „exogene Variable“ macht das Modell blind.
Der Rückspiegel hilft – aber verzerrt die Sicht
Ein weiterer Grund für die Anfälligkeit von Prognosen liegt in der Art und Weise, wie wir Menschen mit Informationen umgehen. Wir neigen dazu, der Vergangenheit ein höheres Gewicht zu geben als der Gegenwart. Wer 2008 den Finanzcrash erlebt hat, bleibt lange vorsichtig. Wer 2020 von der rasanten Erholung überrascht wurde, unterschätzt vielleicht die künftigen Risiken.
Diese kognitive Verzerrung – der sogenannte Rückschaufehler – sorgt dafür, dass viele Prognosen mehr über vergangene Erfahrungen als über zukünftige Entwicklungen aussagen. Es ist weniger eine Vorhersage als ein Musterabgleich. Und Muster können trügen.
Zahlen, die beruhigen – Modelle, die täuschen
Ein weiterer Trugschluss besteht in der Überbewertung mathematischer Präzision. Prognosen arbeiten mit Prozentpunkten, Basiswerten, Konfidenzintervallen – was nach Wissenschaft aussieht, erzeugt Vertrauen. Doch häufig verleiht die formale Genauigkeit nur eine trügerische Sicherheit.
Wenn ein Institut sagt, der Leitzins steige „voraussichtlich auf 3,75 % im ersten Quartal“, wirkt das solide. Doch schon eine Woche später kann ein geopolitischer Schock alles ändern. Die Vorhersage hat dann keinen Wert mehr – aber sie bleibt im kollektiven Gedächtnis.
Warum trotzdem alle prognostizieren – und alle zuhören
box
Trotz all dieser Schwächen wird unablässig prognostiziert. Dafür gibt es mehrere Gründe:
- Ökonomischer Druck: Finanzinstitute müssen zeigen, dass sie Expertise haben. Eine fundierte Einschätzung gehört zum Geschäftsmodell.
- Medienlogik: Schlagzeilen mit klaren Vorhersagen verkaufen sich besser als differenzierte Ungewissheiten.
- Psychologisches Bedürfnis: Anleger sehnen sich nach Orientierung – selbst wenn sie wissen, dass Prognosen unzuverlässig sind.
Prognosen bedienen also ein menschliches Grundbedürfnis: die Illusion von Kontrolle über das Ungewisse.
Fazit: Orientierung statt Orakel
Prognosen werden bleiben – und das ist auch gut so, solange man sie richtig einordnet. Sie sind nicht Wahrheit, sondern Perspektive. Wer sie als Denkanstoß nutzt, als Möglichkeit, Szenarien zu entwickeln und Handlungsoptionen zu prüfen, der kann von ihnen profitieren.
Wer sie aber als Entscheidungsvorlage oder gar als Gewissheit interpretiert, läuft Gefahr, falsche Schlüsse zu ziehen – und sein Portfolio gegen Annahmen statt gegen Risiken zu schützen. Finanzmärkte folgen keiner Uhr. Aber wer das akzeptiert, kann mit mehr Klarheit und Gelassenheit investieren.
Transparente, faire, nachhaltige und unabhängige Finanzberatung seit 1998