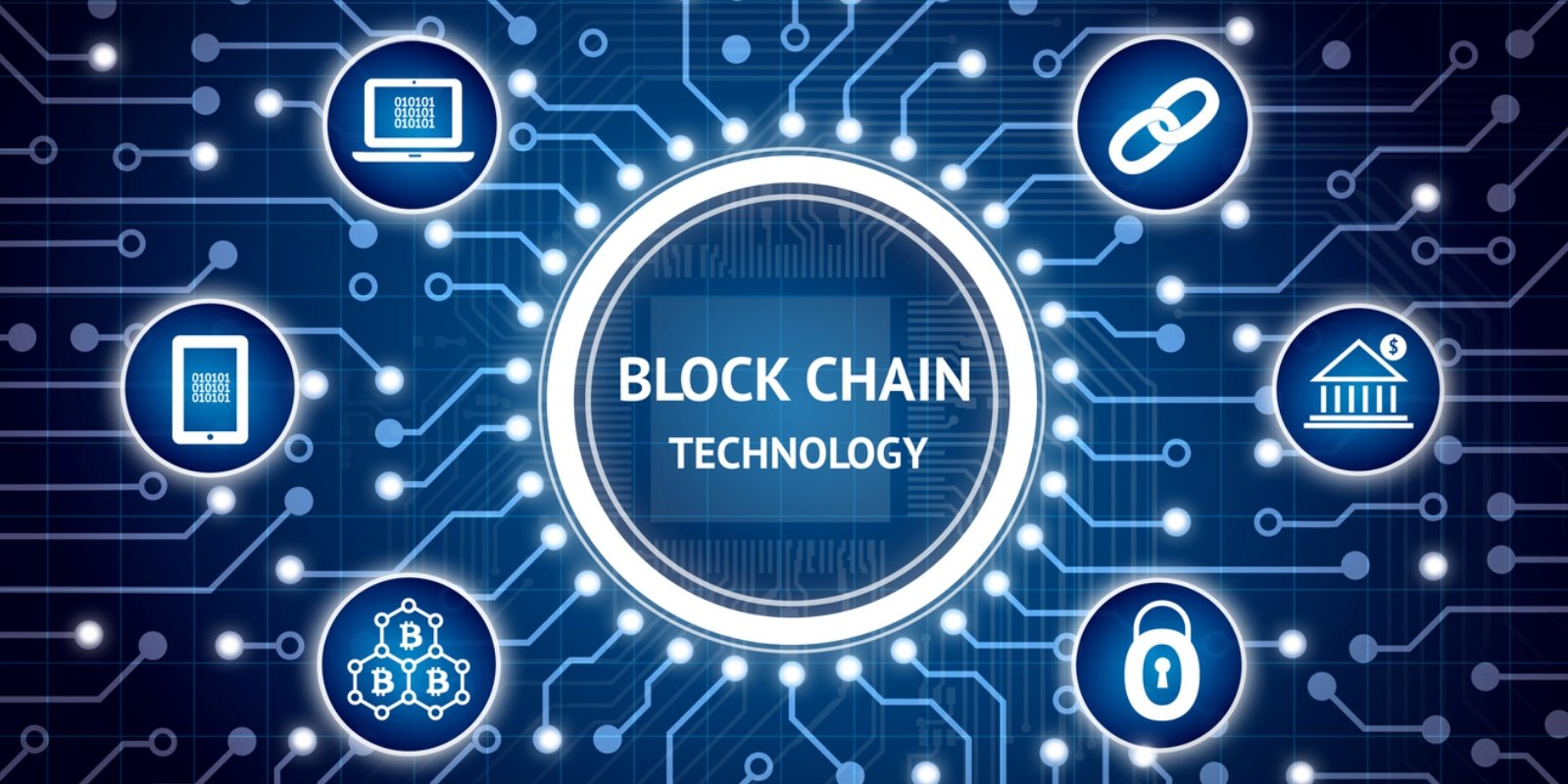Deutschland immer einsamer Rückkehr der Atomkraft
In der europäischen Energiepolitik bahnt sich ein tiefgreifender Richtungsstreit an. Während Deutschland nach langem politischem Ringen den Ausstieg aus der Atomkraft vollzogen hat und konsequent auf erneuerbare Energien setzt, mehren sich im restlichen Europa die Zeichen einer Renaissance der Kernenergie.
Besonders deutlich wird das in Belgien: Das Land vollzieht eine 180-Grad-Wende in seiner Energiepolitik und kündigt nicht nur den Ausstieg aus dem Atomausstieg an, sondern strebt nun aktiv ein Bündnis mit anderen Staaten an, die auf Atomkraft als Schlüsseltechnologie der Dekarbonisierung setzen.
Damit zeichnet sich eine neue Nuklear-Allianz ab – mit Staaten wie Frankreich, Finnland, Schweden, Tschechien, Polen, den Niederlanden und nun auch Belgien –, während Deutschland zunehmend isoliert dasteht. Es ist eine Konstellation, die den energiepolitischen Diskurs der kommenden Jahre maßgeblich prägen dürfte.
Belgien als neuer Katalysator der Atomwende
Die Entscheidung Belgiens, den ursprünglich für 2025 vorgesehenen vollständigen Atomausstieg rückgängig zu machen, kommt nicht aus heiterem Himmel. Bereits in den vergangenen Jahren war das Land angesichts wachsender Stromnachfrage, geopolitischer Unsicherheiten und des langsamen Ausbaus erneuerbarer Energien ins Straucheln geraten. Die Energiekrise infolge des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine hat diese Entwicklung zusätzlich beschleunigt.
Nun hat die belgische Regierung angekündigt, nicht nur zwei bestehende Reaktoren weiter betreiben zu wollen, sondern auch aktiv die Entwicklung neuer Reaktortechnologien voranzutreiben – etwa sogenannte SMRs (Small Modular Reactors), die als flexibel einsetzbare, sicherere und effizientere Alternative zur konventionellen Großtechnologie gelten. Diese Entscheidung ist nicht nur nationalpolitisch bedeutsam, sondern hat europäische Signalwirkung.
Denn Belgien stellt sich damit klar auf die Seite jener Länder, die Atomkraft nicht als überkommene Technik, sondern als Brückentechnologie und Zukunftssäule einer CO₂-neutralen Energieversorgung verstehen.
Die neue Nuklear-Allianz in Europa
box
Was sich im Hintergrund abzeichnet, ist mehr als nur eine lose Interessenübereinstimmung: Mehrere europäische Länder haben in den vergangenen Monaten ihre Absicht bekundet, gemeinsame Projekte zur Kernenergieentwicklung auf den Weg zu bringen. Unter dem Dach der EU – aber oft jenseits der deutschen Einflusslinie – arbeiten Staaten an gemeinsamen Förderprogrammen, Sicherheitsstandards, Forschungskooperationen und sogar an abgestimmten Finanzierungsstrategien für neue Reaktortypen.
Diese Entwicklung läuft auf eine institutionalisierte Nuklear-Allianz hinaus, die sich inhaltlich wie geopolitisch zunehmend vom deutschen Kurs absetzt. Getragen wird sie insbesondere von:
- Frankreich, das mit seiner langjährigen Atomtradition als politischer und technologischer Anker fungiert,
- Osteuropäischen Ländern wie Polen, Tschechien, Ungarn oder Rumänien, die Atomkraft als Weg zur Unabhängigkeit von fossilen Importen sehen,
- Skandinavischen Staaten, in denen die Versorgungssicherheit bei gleichzeitiger Klimaneutralität Priorität hat.
Belgien wird nun zum symbolischen Bindeglied dieser Bewegung. Ein Land, das einst wie Deutschland aussteigen wollte – und sich nun entschlossen der Gegenrichtung anschließt.
Deutschlands Sonderweg: Konsequenz mit wachsender Gegenwehr
Während sich in Europa die Reihen der Atomkraftbefürworter schließen, bleibt Deutschland bei seinem Atomausstiegskurs. Seit dem endgültigen Abschalten der letzten Reaktoren im Jahr 2023 verfolgt Berlin das Ziel, eine klimaneutrale Energieversorgung allein durch erneuerbare Energien, Energiespeicher und grenzüberschreitenden Stromhandel zu sichern.
Dieser Weg ist technisch ambitioniert, politisch folgerichtig aus der Geschichte abgeleitet und gesellschaftlich mehrheitlich akzeptiert. Doch er ist zunehmend mit Herausforderungen konfrontiert: Netzausbau, Speichertechnologie, volatile Strompreise und Importabhängigkeiten sorgen immer wieder für Diskussionen – auch über die Sinnhaftigkeit des Verzichts auf eine CO₂-arme Grundlasttechnologie wie die Kernenergie.
International stößt Deutschlands Kurs dabei zunehmend auf Unverständnis. Für viele Partnerländer wirkt der deutsche Sonderweg nicht nur teuer, sondern auch widersprüchlich, da Deutschland Stromimporte aus Ländern bezieht, die ihrerseits auf Atomkraft setzen. Der Vorwurf: Man lasse sich die Dekarbonisierung letztlich doch von der Kernkraft „miterledigen“, ohne eigene Verantwortung für deren Ausbau zu übernehmen.
Sicherheits- und Umweltfragen bleiben umstritten
Die Entscheidung Belgiens markiert einen Wendepunkt im europäischen Diskurs über Atomkraft. Sie zeigt, dass der deutsche Weg keinen internationalen Konsens mehr darstellt, sondern zunehmend als Sonderfall betrachtet wird. Während sich anderswo Allianzen für die Renaissance der Kernenergie bilden, steht Deutschland – technisch ambitioniert, aber geopolitisch isoliert – auf weiter Flur."
Trotz der Rückkehr der Atomkraft auf die politische Agenda vieler Staaten bleiben die Grundsatzfragen ungelöst. Sicherheitsbedenken, ungelöste Endlagerprobleme, hohe Kosten und lange Bauzeiten stehen auch heute im Raum. Doch die Wahrnehmung dieser Probleme hat sich gewandelt: In einer Welt der Klimakrise, geopolitischen Risiken und wachsender Stromnachfrage erscheinen diese Argumente für viele Politiker nicht mehr als Ausschlusskriterium, sondern als Teil einer komplexen Abwägung.
In Deutschland hingegen hat die Anti-Atomkraft-Bewegung eine tiefere kulturelle Verwurzelung. Die Erinnerung an Tschernobyl, der Schock von Fukushima, aber auch das starke zivilgesellschaftliche Engagement gegen Atomprojekte haben den Diskurs langfristig geprägt. Diese historische Prägung führt dazu, dass in Deutschland die Debatte über eine Rückkehr zur Kernenergie noch als tabuisiert gilt, obwohl sich die Lage in Europa grundlegend verschoben hat.
Die politische Dimension: EU-Kohäsion auf dem Prüfstand
Die wachsende Zahl an Atomkraftstaaten innerhalb der EU und der Sonderweg Deutschlands werfen auch institutionelle Fragen auf. In Brüssel tobt bereits seit Jahren ein Streit über die Taxonomie-Verordnung, also die Frage, ob Atomkraft als „grüne“ Technologie gelten darf. Frankreich und seine Verbündeten drängen auf eine Anerkennung als nachhaltige Investition, um private und öffentliche Mittel für den Ausbau zu mobilisieren. Deutschland hingegen stemmt sich – bislang erfolglos – gegen eine solche Einordnung.
Auch auf diplomatischer Ebene wächst die Kluft. Wo früher gemeinsame Positionen zur Energiepolitik formuliert wurden, entstehen heute zwei konkurrierende Lager: ein nukleares Kern-Europa und ein dezidiert anti-nukleares Deutschland. Der Befund ist ernüchternd: Die Energieunion der EU, einst als gemeinsame strategische Antwort auf die Klimakrise gedacht, droht energiepolitisch auseinanderzudriften.
Fazit: Deutschland steht energiepolitisch immer mehr allein
Die Entscheidung Belgiens markiert einen Wendepunkt im europäischen Diskurs über Atomkraft. Sie zeigt, dass der deutsche Weg keinen internationalen Konsens mehr darstellt, sondern zunehmend als Sonderfall betrachtet wird. Während sich anderswo Allianzen für die Renaissance der Kernenergie bilden, steht Deutschland – technisch ambitioniert, aber geopolitisch isoliert – auf weiter Flur.
Ob dies auf lange Sicht eine Schwäche oder ein mutiges Vorbild sein wird, ist offen. Klar ist jedoch: Die Debatte um die Rolle der Atomkraft in einer klimaneutralen Energiezukunft ist nicht abgeschlossen, sondern neu entbrannt – und Deutschland muss sich darauf einstellen, diese Debatte künftig nicht mehr allein mit sich selbst zu führen.

Ich glaube, dass die Zusammenarbeit mit motivierten Menschen auf beiden Seiten zusätzliche Energie freisetzt