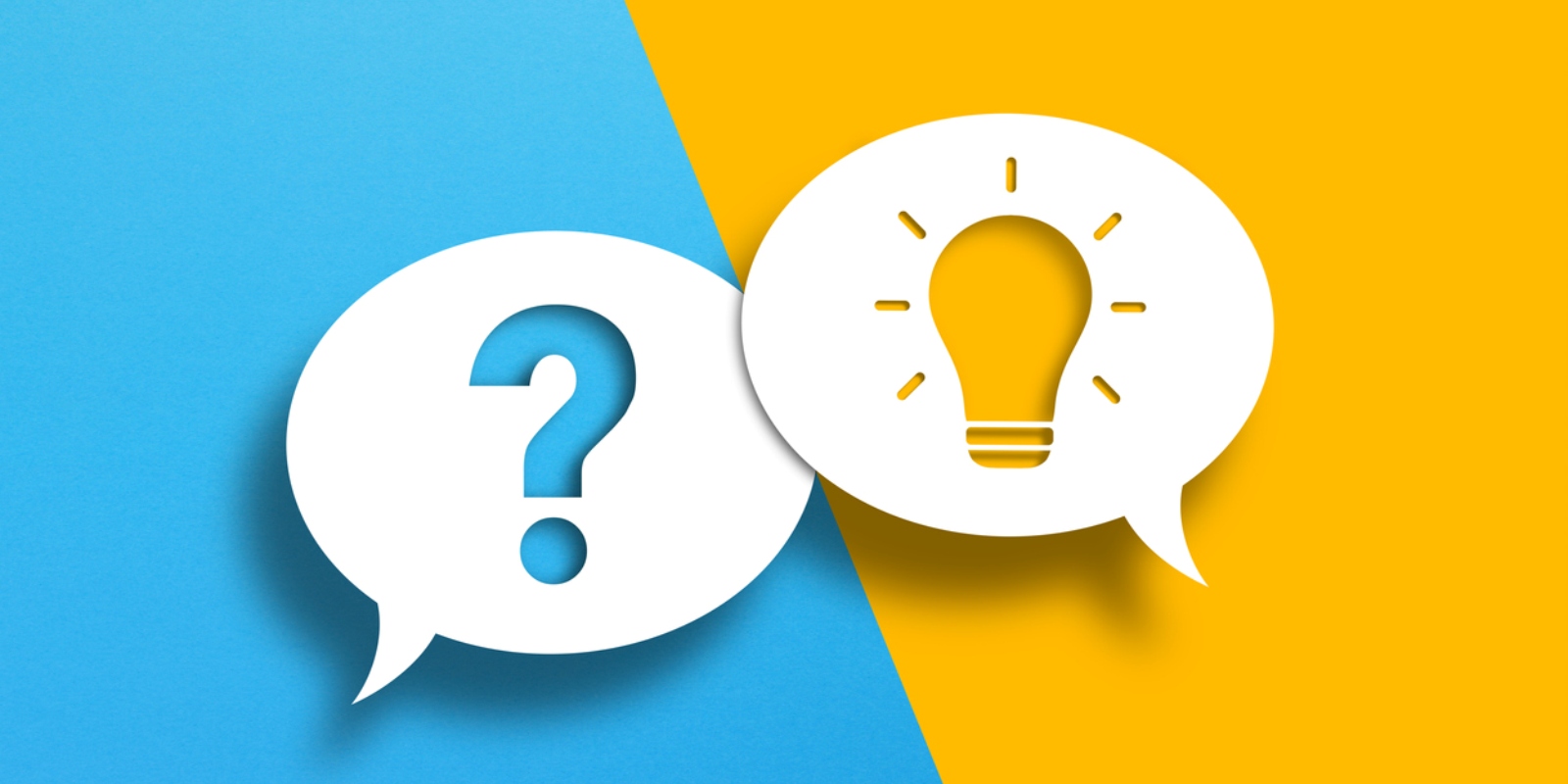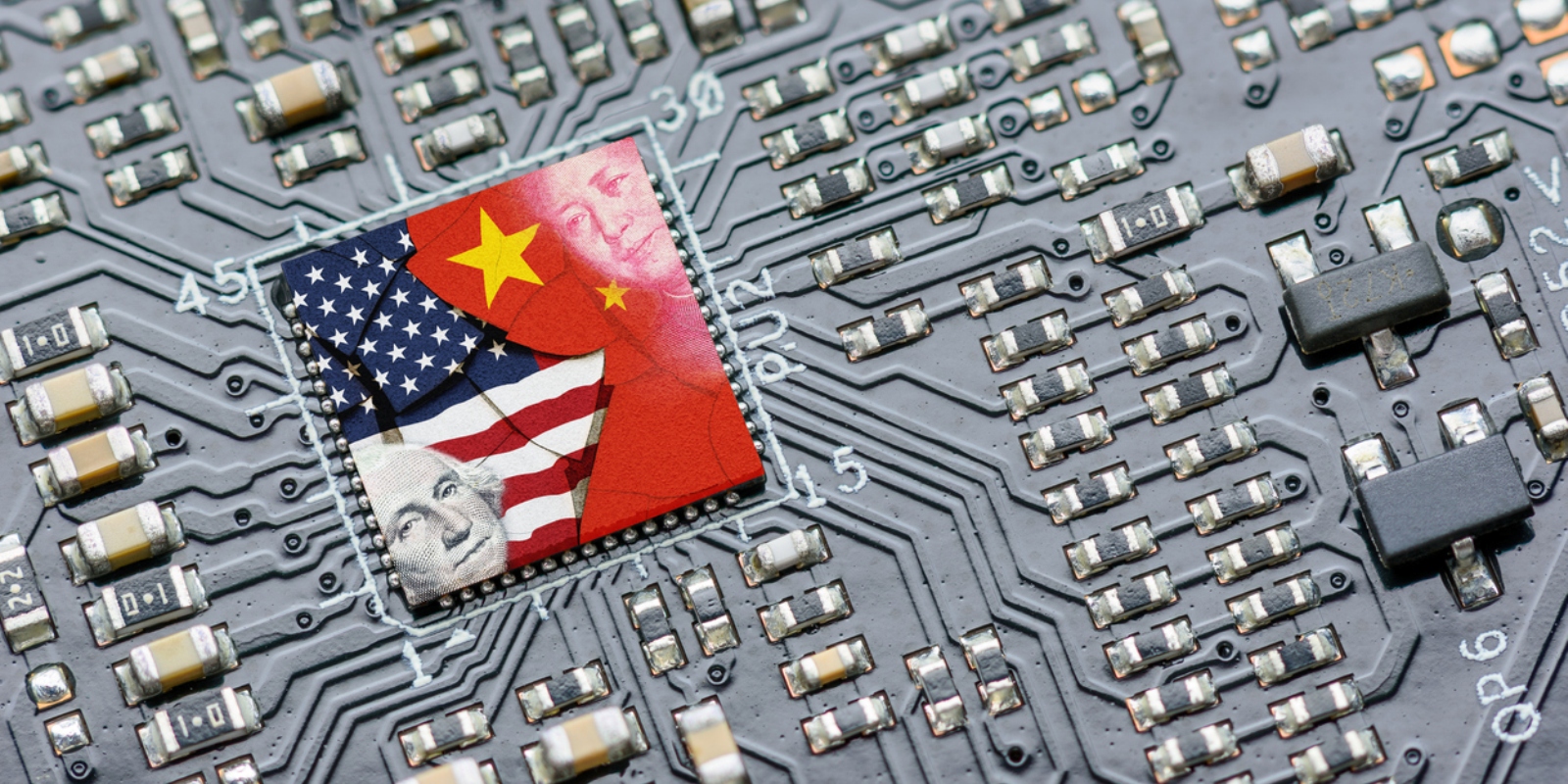Europa unter amerikanischer Kontrolle Technologische Souveränität
Die Digitalisierung hat Wirtschaft, Verwaltung und Gesellschaft in ein neues Zeitalter geführt – mit gewaltigen Effizienzgewinnen, neuen Geschäftsmodellen und globaler Vernetzung. Doch während europäische Staaten sich zunehmend auf digitale Infrastrukturen verlassen, kommt eine unbequeme Wahrheit ans Licht: Die technologische Abhängigkeit von den USA ist größer denn je.
Petabytes an Daten aus Europa – von Unternehmen, Behörden, Krankenhäusern, Universitäten und sogar sicherheitsrelevanten Einrichtungen – liegen auf Servern amerikanischer Tech-Giganten. Namen wie Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure und Google Cloud dominieren den europäischen Markt für Cloud-Dienste. Diese Dominanz ist nicht nur wirtschaftlich bedenklich, sondern zunehmend auch politisch brisant.
Die Sorge wächst, dass Europa zur „Datenkolonie“ wird – ein Kontinent, der digitale Infrastruktur nutzt, aber nicht kontrolliert. Die Frage nach technologischer Souveränität stellt sich damit drängender denn je.
Die Daten liegen woanders – und damit auch die Macht
Im digitalen Zeitalter sind Daten das zentrale Gut. Sie entscheiden über Innovation, Effizienz, Sicherheit und Wettbewerbsfähigkeit. Wer Daten kontrolliert, kann Märkte steuern, Verhalten analysieren und strategische Vorteile sichern. Doch genau hier liegt Europas Problem: Die Kontrolle über zentrale IT-Infrastrukturen, Softwareplattformen und Cloud-Dienste liegt nicht bei europäischen Anbietern, sondern bei US-amerikanischen Konzernen, die nach US-Recht operieren – und damit auch deren Sicherheits- und Auskunftspflichten unterliegen.
Das bedeutet konkret: Daten, die in Frankfurt oder Paris gespeichert werden, können unter bestimmten Bedingungen von amerikanischen Behörden eingefordert werden – etwa auf Basis des Cloud Act, eines 2018 verabschiedeten US-Gesetzes. Selbst dann, wenn die Daten physisch in Europa lagern, unterliegen sie der Zugriffshoheit amerikanischer Strafverfolgungs- und Geheimdienste – sofern sie von US-Anbietern gehostet werden.
Diese strukturelle Abhängigkeit schafft ein Machtgefälle, das mit klassischer Datensicherheit nicht mehr viel zu tun hat. Es geht längst nicht nur um Datenschutz, sondern um digitale Souveränität als geopolitische Dimension.
Warum Europa ins Hintertreffen geraten ist
box
Die Ursachen für diese Abhängigkeit sind vielschichtig. Einerseits liegt es an der Innovationskraft und Skalierbarkeit der US-Technologiekonzerne. Sie haben frühzeitig investiert, global expandiert und ihre Dienste mit enormer Rechenpower, hoher Verfügbarkeit und einfacher Nutzbarkeit versehen.
- koordinierten politischen Initiativen mit Langfristwirkung
- Risikokapital für europäische IT-Unternehmen
- einer gemeinsamen digitalen Industriepolitik auf EU-Ebene
- öffentlicher Beschaffung, die strategische Ziele über kurzfristige Kosten stellt
Die Folge: Selbst kritische Infrastrukturen in der öffentlichen Verwaltung, bei Energieversorgern oder im Gesundheitswesen laufen auf US-Systemen. Und selbst dort, wo europäische Anbieter existieren, fehlt ihnen oft die Wettbewerbsfähigkeit – sei es in Preis, Skalierbarkeit oder technischer Exzellenz.
GAIA-X und andere Versuche: Ein schwieriger Aufbruch
Europa steht an einem Scheideweg. Die Abhängigkeit von amerikanischen Tech-Konzernen ist weder überraschend noch unumkehrbar – aber sie ist hochgradig gefährlich, wenn sie nicht aktiv und entschlossen angegangen wird."
Mit Projekten wie GAIA-X versucht Europa inzwischen, eigene Wege zu gehen. Die Initiative wurde 2019 von Deutschland und Frankreich ins Leben gerufen und verfolgt das Ziel, eine vertrauenswürdige europäische Dateninfrastruktur zu schaffen – interoperabel, transparent und sicher. Doch die Umsetzung stockt. Unterschiedliche Interessen, mangelnde Geschwindigkeit und die Kooperationsbeteiligung von US-Konzernen selbst haben Zweifel an der Wirksamkeit des Projekts geweckt.
Zudem fehlt es an verbindlichen politischen Vorgaben, die der öffentlichen Hand vorschreiben würden, europäische Anbieter bevorzugt zu nutzen – etwa bei Cloud-Diensten für Ministerien oder kommunale Rechenzentren. Der Preis ist oft das ausschlaggebende Kriterium, nicht die Frage der Datenhoheit.
Wenn jedoch selbst staatliche Institutionen US-Clouds nutzen, sendet das ein fatales Signal an den Markt – und konterkariert die politische Rhetorik technologischer Unabhängigkeit.
Die Folgen: strategische Verwundbarkeit und geopolitischer Kontrollverlust
Die Abhängigkeit Europas von amerikanischer IT-Infrastruktur ist nicht nur ein wirtschaftliches Problem – sie ist ein sicherheitspolitisches Risiko. In einer Welt zunehmender geopolitischer Spannungen kann der Zugriff auf Daten, Plattformen und IT-Dienste zu einem strategischen Hebel werden. Denkbar sind Szenarien, in denen politische Konflikte zu digitalen Erpressungspotenzialen führen – etwa durch Sanktionen, Zugriffsverweigerungen oder Überwachung.
Auch Innovation leidet unter Abhängigkeit. Wer seine Datenbasis, seine Rechenkapazität und seine Entwicklungsumgebungen nicht kontrolliert, kann auf Dauer keine echten digitalen Ökosysteme aufbauen, die unabhängig, resilient und europäisch geprägt sind.
Langfristig droht Europa in eine digitale Passivrolle zu geraten: als Nutzer fremder Technologien, aber ohne strategische Kontrolle – mit allen Konsequenzen für Wettbewerbsfähigkeit, Datenschutz, Demokratie und Souveränität.
Fazit: Die Stunde der digitalen Selbstbehauptung
Europa steht an einem Scheideweg. Die Abhängigkeit von amerikanischen Tech-Konzernen ist weder überraschend noch unumkehrbar – aber sie ist hochgradig gefährlich, wenn sie nicht aktiv und entschlossen angegangen wird.
Technologische Souveränität bedeutet nicht Autarkie. Es geht nicht darum, sich von der Welt abzuschotten, sondern darum, Gestaltungsspielräume zurückzugewinnen, Entscheidungsfreiheit zu wahren und eigene Regeln durchsetzen zu können – auf Servern, in Softwarearchitekturen und bei der Frage, wer Zugriff auf unsere Daten hat.
Dazu braucht es politische Klarheit, wirtschaftliche Investitionen und eine neue Prioritätensetzung in Beschaffung und Förderung. Wenn Europa vermeiden will, zur digitalen Kolonie zu werden, muss es handeln – jetzt.

"Finanzplanung ist Lebensplanung - Geben Sie beidem nachhaltig Sinn!"