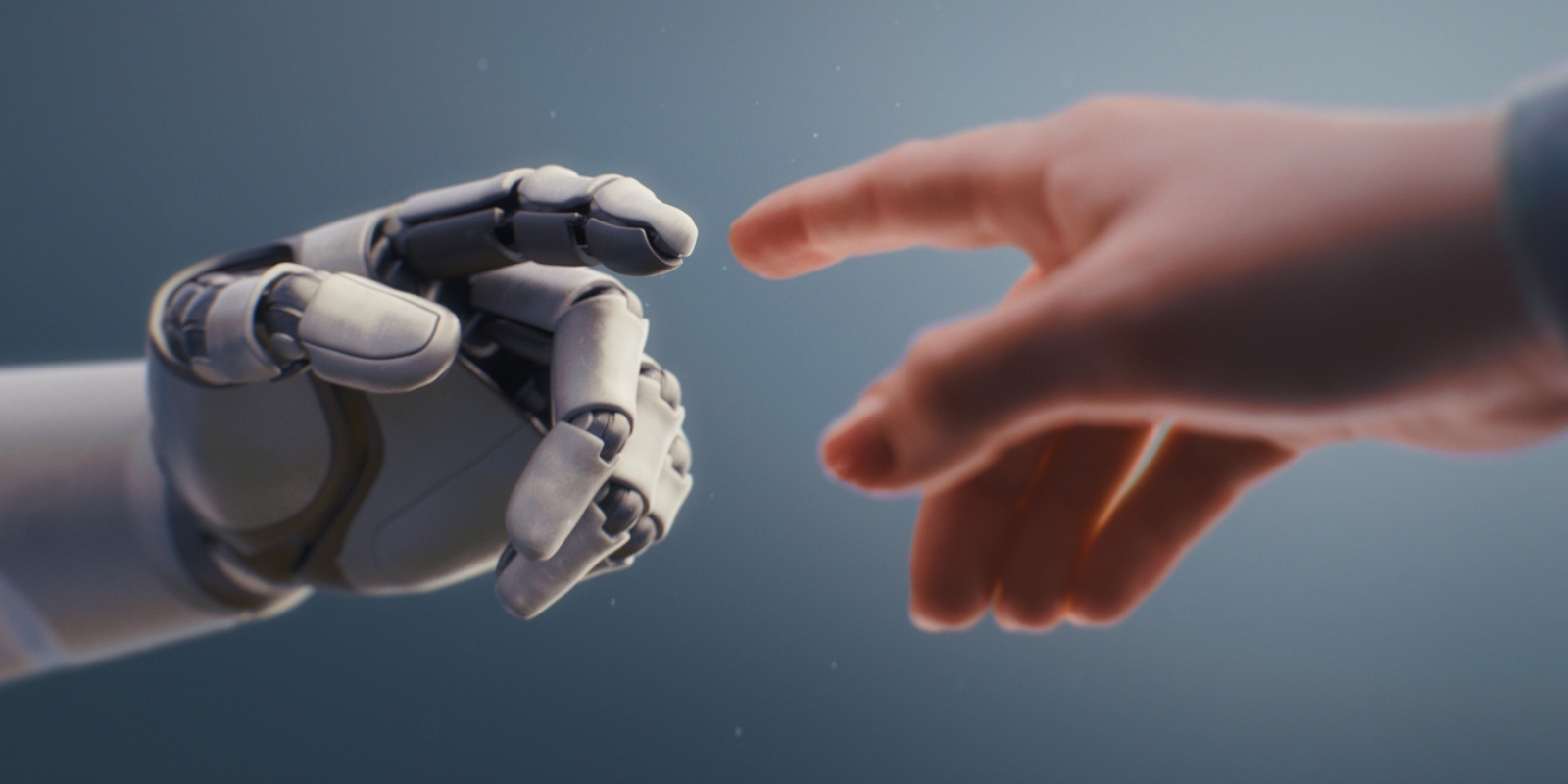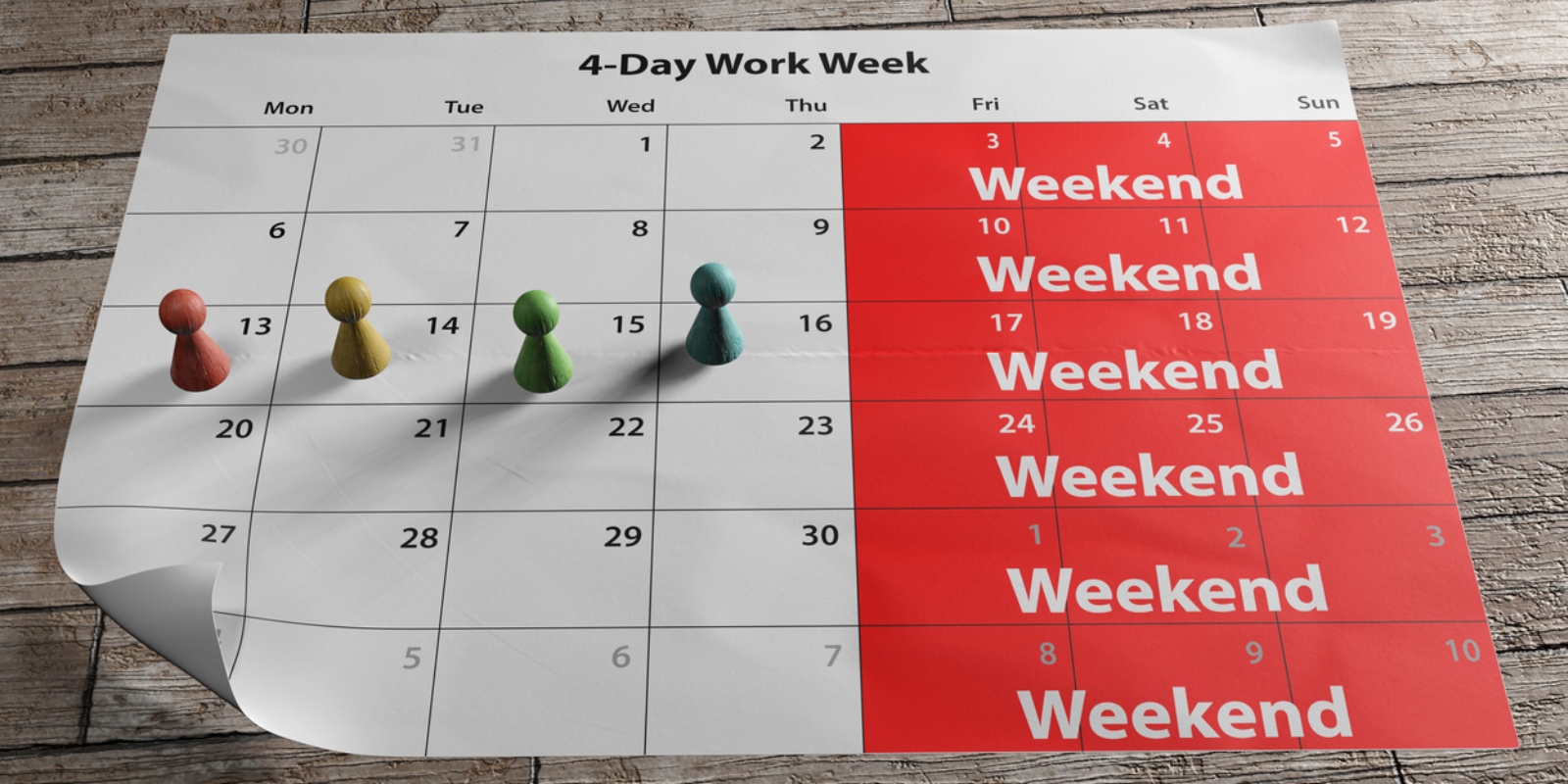Binnen zwölf Monaten jede dritte Filiale Großbanken schließen Filialen
Der Rückzug aus der Fläche beschleunigt sich – was hinter dem Filialsterben steckt und was es für Kunden, Mitarbeiter und den Finanzmarkt bedeutet.
Der Rückbau des klassischen Filialnetzes deutscher Banken ist kein neues Phänomen – aber in den letzten zwölf Monaten hat er eine neue Dynamik angenommen. Besonders bei den Großbanken hat sich der Schrumpfungsprozess massiv beschleunigt. Laut der aktuellen Bankenstellenstatistik der Deutschen Bundesbank sank die Zahl der Zweigstellen dieser Institute innerhalb eines Jahres um mehr als ein Drittel. Ein solcher Rückgang in so kurzer Zeit markiert einen tiefgreifenden Einschnitt.
Die Entwicklung ist Teil eines umfassenderen Strukturwandels, der seit Jahren anhält: Digitalisierung, Kostendruck, verändertes Kundenverhalten und regulatorische Anforderungen treiben die Konsolidierung des Filialnetzes voran. Doch das Tempo, mit dem nun besonders die großen Player ihre stationäre Präsenz abbauen, wirft neue Fragen auf – nach Zugänglichkeit, Servicequalität und dem Selbstverständnis des Bankwesens.
Die wichtigsten Gründe für den massiven Rückbau
box
Hinter dem Filialsterben stehen mehrere strukturelle Ursachen, die sich gegenseitig verstärken:
Erstens haben digitale Kanäle das Kundenverhalten tiefgreifend verändert.
Immer mehr Menschen erledigen Überweisungen, Wertpapiergeschäfte oder Beratungsgespräche online oder mobil. Filialen werden seltener besucht – selbst bei älteren Kunden.
Zweitens kämpfen viele Banken mit anhaltendem Kostendruck.
In Zeiten hoher IT-Investitionen, steigender regulatorischer Anforderungen und sinkender Margen in der Zinslandschaft werden Filialen zunehmend als betriebswirtschaftliche Belastung gesehen.
Drittens versuchen die Großbanken, ihre Strukturen zu verschlanken, um flexibler auf Marktveränderungen reagieren zu können.
Die Folge ist eine zunehmende Zentralisierung von Prozessen – Beratung und Service wandern in Callcenter, Videochats oder digitale Plattformen.
Besonders betroffen: ländliche Regionen und Filialstandorte mit geringer Nutzung
Der Rückbau verläuft nicht flächendeckend gleich, sondern folgt einer klaren Logik: Zuerst verschwinden die Filialen, die wenig Kundenfrequenz aufweisen, hohe Fixkosten verursachen oder sich in Konkurrenznähe zu anderen Standorten befinden. Vor allem im ländlichen Raum dünnt sich das Netz drastisch aus.
Für viele Kundinnen und Kunden bedeutet das längere Wege, weniger persönliche Ansprechbarkeit – oder gleich der komplette Umstieg auf digitale Angebote. Besonders betroffen sind ältere Menschen, kleine Unternehmen und Vereine, die auf persönliche Nähe, Bargeldversorgung oder unkomplizierte Unterstützung angewiesen sind.
Was das für das Selbstverständnis der Banken bedeutet
Die Schließung jeder dritten Großbank-Filiale binnen zwölf Monaten ist Ausdruck einer strategischen Neuvermessung des Bankgeschäfts. Filialen sind in dieser Logik Kostenfaktor, nicht Standortvorteil. Das mag betriebswirtschaftlich folgerichtig sein – gesellschaftlich aber wirft es Fragen auf: zur Erreichbarkeit von Finanzdienstleistungen, zur Verantwortung von Banken im öffentlichen Raum und zur Zukunft des persönlichen Bankings."
Die radikale Ausdünnung des Filialnetzes ist nicht nur eine betriebswirtschaftliche Entscheidung – sie verändert das gesellschaftliche Bild von Banken. Jahrzehntelang waren sie mit ihren Zweigstellen sichtbare, verlässliche Institutionen vor Ort. Wer heute durch Kleinstädte geht, sieht stattdessen leere Schaufenster, einstige Filialen als Coworking Spaces oder Kaffeebars.
Großbanken stehen damit vor einem Spagat: Sie wollen einerseits effizient wirtschaften und den Erwartungen digital affiner Kunden gerecht werden, andererseits aber Nähe und Vertrauen wahren. Das gelingt nur bedingt – gerade dort, wo die letzte Filiale im Umkreis geschlossen wurde, entsteht ein Vakuum. Die Bank wird abstrakter, distanzierter – und damit für manche auch entbehrlicher.
Alternativen: neue Formate, aber keine echte Lösung
Zwar experimentieren einige Institute mit mobilen Filialen, Self-Service-Terminals oder Beratung per Videochat in kleinen Einheiten, doch echte Ersatzstrukturen sind rar. Was verloren geht, ist mehr als nur ein Schalter: Es ist die sozialräumliche Präsenz eines Finanzakteurs, der lange als Teil lokaler Infrastruktur galt.
Einige Banken setzen auf „Flagship Stores“ in Ballungszentren – technisch hochgerüstet, architektonisch ambitioniert. Doch sie bleiben die Ausnahme. Der Trend zur Entmaterialisierung ist nicht aufzuhalten – und findet zunehmend auch bei Sparkassen und Genossenschaftsbanken Nachahmer.
Fazit: Das Filialnetz als Opfer der Effizienzlogik
Die Schließung jeder dritten Großbank-Filiale binnen zwölf Monaten ist Ausdruck einer strategischen Neuvermessung des Bankgeschäfts. Filialen sind in dieser Logik Kostenfaktor, nicht Standortvorteil. Das mag betriebswirtschaftlich folgerichtig sein – gesellschaftlich aber wirft es Fragen auf: zur Erreichbarkeit von Finanzdienstleistungen, zur Verantwortung von Banken im öffentlichen Raum und zur Zukunft des persönlichen Bankings.
Für viele Kunden bleibt ein Gefühl zurück: Die Bank ist noch da – aber nicht mehr nah. Wie sich diese neue Distanz langfristig auf Vertrauen, Kundenbindung und Marktposition auswirkt, ist offen. Sicher ist nur: Der Rückzug aus der Fläche ist real – und er verändert mehr als nur die Anzahl der Filialen.

Ich glaube, dass Menschen, die sich ihrer Ziele und Werte bewusst werden, sorgenfreier leben.