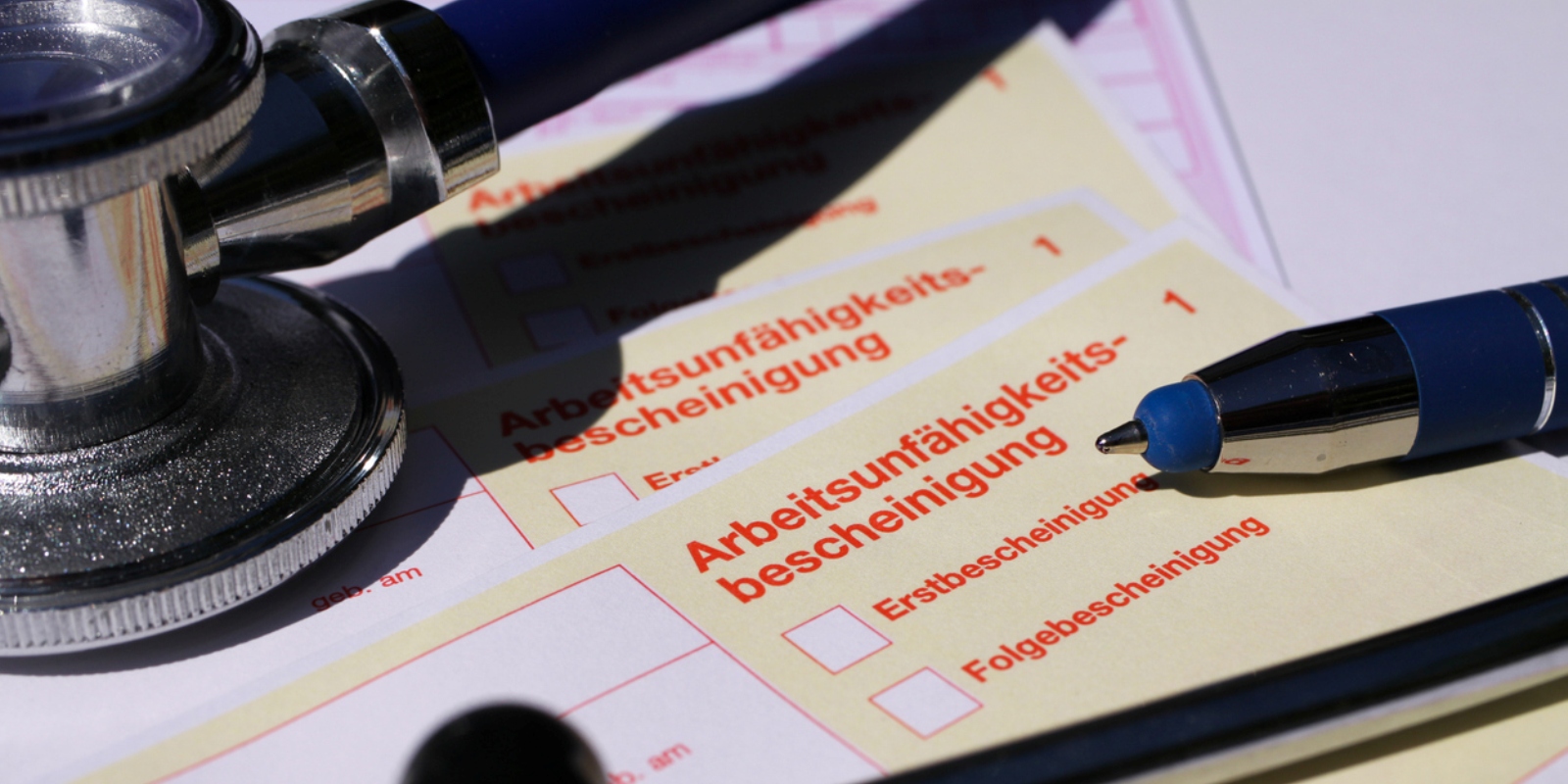Neue Rolle der Wirtschaft Militärische Landesverteidigung
Deutschland steht vor einer sicherheitspolitischen Zeitenwende, die weit über die Bundeswehr hinausreicht. Seit dem russischen Angriff auf die Ukraine und der Rückkehr militärischer Bedrohungsszenarien auf europäischem Boden ist klar: Landes- und Bündnisverteidigung sind nicht mehr nur Aufgabe der Streitkräfte, sondern erfordern die aktive Einbindung von Wirtschaft, Verwaltung und Gesellschaft.
Ein zentrales Element dieser neuen Gesamtstrategie ist der sogenannte „Operationsplan Deutschland“, mit dem die Bundeswehr Deutschland im Krisen- oder Verteidigungsfall zur logistischen Drehscheibe der NATO machen will. Hinter dem nüchtern klingenden Begriff verbirgt sich ein umfassender Plan, wie Infrastruktur, Wirtschaft und zivile Ressourcen im Ernstfall mobilisiert werden sollen – nicht irgendwann, sondern absehbar bald. Die Wirtschaft spielt dabei eine Schlüsselrolle.
Drehscheibe im Ernstfall: Deutschlands neue strategische Rolle
Im Zentrum des Plans steht eine klare militärische Zielsetzung: Im Falle eines bewaffneten Konflikts an der NATO-Ostflanke muss Deutschland in der Lage sein, binnen kürzester Zeit Truppen und Material aus dem Westen Europas in Richtung Polen, Baltikum und weiter nach Osten zu verlegen.
Es geht um gewaltige Größenordnungen:
- Hunderttausende NATO-Soldaten, darunter US-amerikanische, französische oder britische Einheiten.
- Tausende Fahrzeuge, Panzer und logistische Systeme.
- Unmengen an Munition, Verpflegung, Treibstoff und medizinischer Ausrüstung.
Diese Kräfte müssen nicht nur bewegt, sondern auch versorgt, repariert, untergebracht und geführt werden. Deutschland wird damit nicht zur Front, aber zur logistischen Lebensader der NATO – ein Szenario, das Planung und Koordination auf höchstem Niveau erfordert.
Der Pakt mit der Wirtschaft: Zusammenarbeit wird Pflicht
box
Der „Operationsplan Deutschland“ basiert auf der Erkenntnis, dass die militärische Mobilität ohne Unterstützung aus der Wirtschaft nicht umsetzbar ist.
Die Bundeswehr verfügt weder über genug Transportkapazitäten noch über ein eigenes Infrastrukturnetz, um diese Aufgabe allein zu bewältigen.
Deshalb wird eine enge Kooperation mit Unternehmen, Verkehrsbetreibern, Energieversorgern, der Bauwirtschaft und der Logistikbranche angestrebt – oder in Teilen verpflichtend gemacht.
Die Bundeswehr spricht hier von „militärischer Ertüchtigung ziviler Fähigkeiten“.
Dazu zählen etwa:
- Bereitstellung von Straßen- und Schienenkapazitäten, speziell bei Autobahnen, Bahntrassen und Brücken.
- Nutzung von zivilen Logistikzentren, Häfen und Flughäfen für militärische Zwecke.
- Zusammenarbeit mit Speditionen, Bahnbetreibern und Infrastrukturunternehmen, um Transporte effizient zu planen.
- Kooperation mit Versorgern, um Energie- und Kommunikationsnetze auch unter Stress aufrechtzuerhalten.
- Einbindung der Bauwirtschaft, um notfalls Lager-, Unterkunfts- oder Verteidigungsanlagen ad hoc zu errichten.
Die Herausforderung liegt darin, diese Zusammenarbeit nicht erst im Ernstfall zu beginnen, sondern sie jetzt, in Friedenszeiten, zu üben, zu vertraglichen Rahmen zu bringen und verlässlich zu gestalten.
Rechtliche und organisatorische Grundlagen
Die Bundeswehr hat mit diesem Plan einen realistischen, aber ambitionierten Rahmen geschaffen, um den NATO-Verpflichtungen nachzukommen. Doch ohne die gezielte und frühzeitige Unterstützung aus der Wirtschaft bleibt er ein theoretisches Konstrukt. Die nächsten Jahre werden zeigen, wie gut sich diese Partnerschaft in der Praxis entwickeln lässt. Verteidigung beginnt heute mit Koordination, Vertrauen – und logistischem Weitblick."
Die Grundlage für diese enge Verzahnung von Militär und Wirtschaft liefert das sogenannte „Wehrpflichtgesetz“ und das weiterentwickelte Konzept der zivilen Verteidigung. Darin ist festgelegt, dass im Verteidigungs- oder Spannungsfall auch private Unternehmen zur Mitwirkung verpflichtet werden können, etwa durch Bereitstellung von Material oder Personal.
Doch der Operationsplan geht noch weiter: Statt auf spontane Improvisation zu setzen, soll im Vorfeld eine strukturierte Planung erfolgen. Dazu zählt:
- Identifikation kritischer Infrastrukturen und Ressourcen.
- Aufbau regionaler Krisenstäbe mit militärischer und ziviler Beteiligung.
- Standardisierte Verfahren für das Zusammenspiel zwischen Bundeswehr und Firmen.
- Kommunikationstrainings, Sicherheitsbriefings und technische Übungen.
Es entsteht eine Art „militärisch-ziviles Netzwerk“, das im Ernstfall sofort aktiviert werden kann – vergleichbar mit einem Rettungsplan, der nicht erst im Brandfall geschrieben wird.
Reaktionen der Wirtschaft: Kooperationsbereit, aber mit Vorbehalten
Viele Unternehmen zeigen grundsätzlich Bereitschaft zur Kooperation, verstehen sich als Teil der gesellschaftlichen Verantwortung und erkennen die neue sicherheitspolitische Lage an. Insbesondere große Logistiker wie DB Cargo, DHL oder Lufthansa Cargo arbeiten bereits an Szenarien mit. Auch Branchenverbände signalisieren Offenheit.
Gleichzeitig gibt es auch Zweifel, Sorgen und offene Fragen:
- Wer haftet im Ernstfall für Schäden oder Ausfälle?
- Wie werden Unternehmen entlastet, wenn sie zivile Kapazitäten für militärische Zwecke bereitstellen?
- Welche Kosten entstehen – und wie werden sie ersetzt?
- Wie wird der Datenschutz bei sensiblen Betriebsinformationen gewährleistet?
Hier ist der Staat gefragt, verlässliche Rahmenbedingungen zu schaffen, Planungssicherheit zu gewährleisten und Kooperation nicht nur einzufordern, sondern auch anzuerkennen und abzusichern.
Fazit: Der Operationsplan Deutschland – eine logistische Mammutaufgabe mit Signalwirkung
Mit dem „Operationsplan Deutschland“ wird klar: Die Verteidigungsfähigkeit eines Landes endet nicht an den Kasernentoren. Sie beginnt in der Gesellschaft, in der Verwaltung – und in der Wirtschaft. Die Fähigkeit, ein Land in kurzer Zeit zur Drehscheibe für internationale Streitkräfte umzuwandeln, ist keine rein militärische – sie ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe.

Ich glaube, dass Menschen, die sich ihrer Ziele und Werte bewusst werden, sorgenfreier leben.