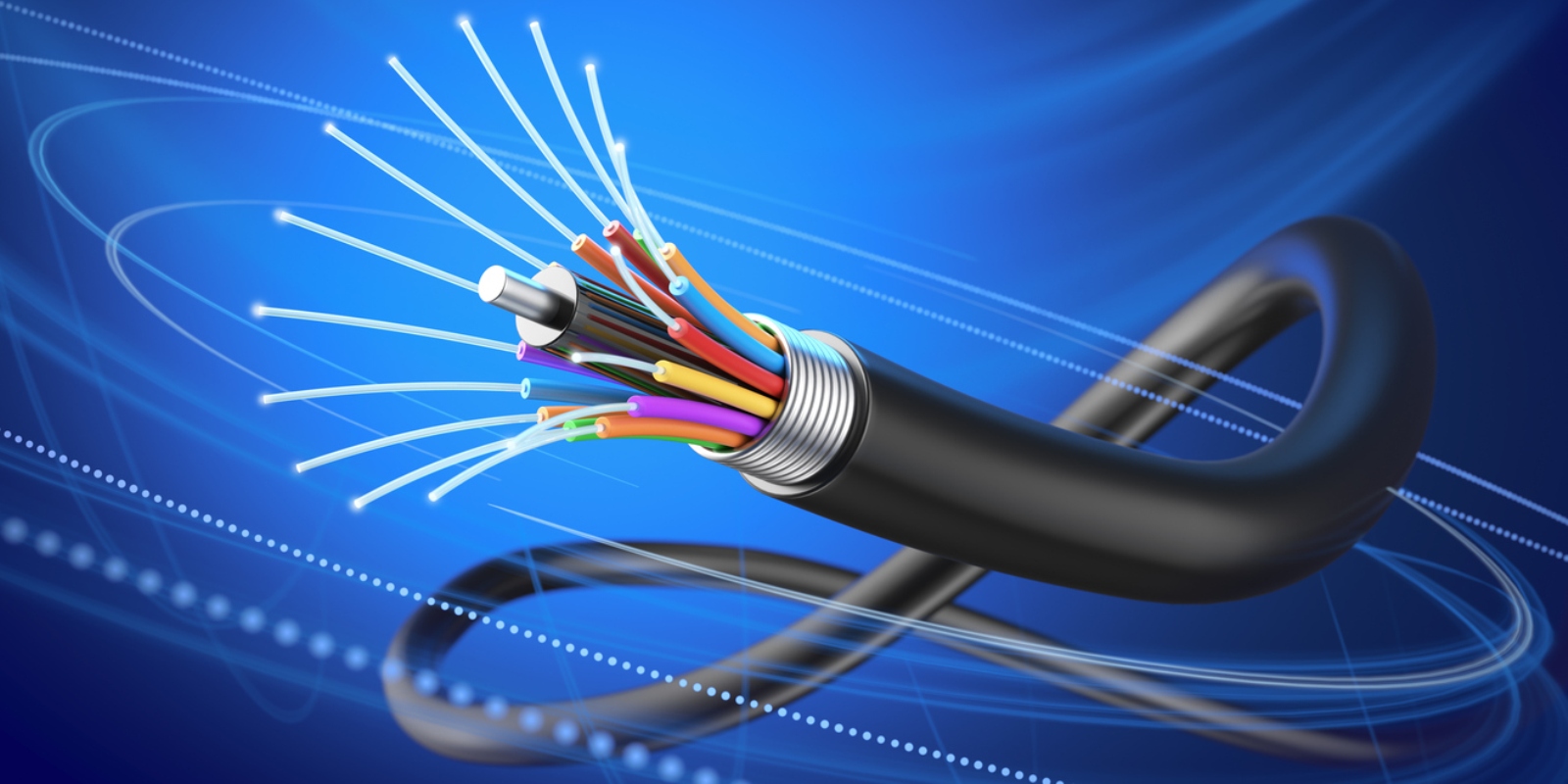Kritik aus den eigenen Reihen Unruhe bei der EZB
Die Europäische Zentralbank (EZB) steht nicht nur geldpolitisch unter Druck, sondern sieht sich zunehmend auch mit internen Spannungen konfrontiert. Eine interne Mitarbeiterbefragung, deren Ergebnisse jüngst öffentlich wurden, offenbart ein tiefes Vertrauensproblem innerhalb der Institution. Besonders brisant: Die Kritik richtet sich nicht etwa an Randerscheinungen, sondern an die Führungskultur selbst – einschließlich der Präsidentin Christine Lagarde.
In den Mittelpunkt der Vorwürfe rückt das, was umgangssprachlich als „Vitamin B“ bezeichnet wird: Beförderungen und Karriereschritte sollen weniger durch Leistung, sondern durch Beziehungen bestimmt sein. Die Folge: Unzufriedenheit, Demotivation und ein wachsendes Misstrauen gegenüber dem Management.
Beförderungssystem in der Kritik: Intransparenz und Vetternwirtschaft?
box
Die Ergebnisse der Befragung zeigen: Viele Mitarbeiter der EZB empfinden die internen Aufstiegsmechanismen als undurchsichtig, ungerecht und politisch motiviert.
Immer wieder fällt dabei der Vorwurf, dass bestimmte Positionen nicht auf Grundlage objektiver Leistungsbewertungen, sondern durch persönliche Netzwerke oder „Seilschaften“ besetzt würden.
Diese Wahrnehmung untergräbt nicht nur das Vertrauen in den internen Wettbewerb, sondern stellt auch die Glaubwürdigkeit der Institution in Frage – gerade weil die EZB gegenüber der Öffentlichkeit stets auf Integrität, Neutralität und Professionalität pocht.
Besonders beunruhigend: Auch hochqualifizierte Fachkräfte äußern laut Umfrage Zweifel an der Fairness der Karrierewege.
Die Konsequenz ist eine sinkende Bindung an den Arbeitgeber, was die EZB in einem ohnehin angespannten Arbeitsmarkt unter Zugzwang setzt.
Führungsstil unter der Lupe – Kritik an Christine Lagarde
Während Christine Lagarde in der Öffentlichkeit als starke Stimme der europäischen Geldpolitik auftritt, mehren sich innerhalb der Bank die Zweifel an ihrem Führungsstil. Mitarbeiter werfen ihr vor, zu wenig Nähe zur Belegschaft zu zeigen und in wesentlichen Personalfragen nicht transparent genug zu agieren.
Dass ausgerechnet die Spitze der Institution im Zentrum der Kritik steht, ist ein Alarmsignal. Denn gerade in einer Organisation wie der EZB, die auf Vertrauen, Konsens und fachliche Exzellenz angewiesen ist, wirkt sich ein beschädigtes Binnenverhältnis schnell auf die Funktionsfähigkeit aus.
Strukturelle Probleme statt Einzelfälle
Wenn die EZB auch künftig Vorbild sein will für Vertrauen in Institutionen, braucht sie mehr als geldpolitische Stabilität: Sie braucht eine Kultur, die auf echter Leistung, klaren Regeln und offener Kommunikation basiert. Nur dann kann sie ihre Rolle als unabhängige, moderne und zukunftsfähige Institution im europäischen System glaubhaft ausfüllen."
Die Kritik beschränkt sich nicht auf Einzelereignisse oder persönliche Konflikte. Vielmehr deuten die Rückmeldungen auf systemische Schwächen im Personalmanagement hin. Neben der Intransparenz bei Beförderungen beklagen viele Befragte:
- Mangel an echter Leistungsbewertung
- Fehlende Feedbackkultur
- Wenig Mitsprache bei internen Veränderungen
- Ein Klima der Unsicherheit und Abhängigkeit
Besonders kritisch wird dabei die fehlende Konsequenz in der Umsetzung interner Reformversprechen gesehen. Programme zur Förderung von Diversität oder zur Entwicklung junger Talente würden zwar angekündigt, aber kaum spürbar umgesetzt.
Was auf dem Spiel steht: Glaubwürdigkeit und Zukunftsfähigkeit
Die Europäische Zentralbank steht nicht nur für Geldpolitik – sie ist Symbol für europäische Stabilität, Integrität und Gemeinwohlorientierung. Wenn jedoch das Vertrauen der eigenen Mitarbeiter schwindet, gefährdet das nicht nur die Moral, sondern langfristig auch die Fähigkeit der EZB, qualifizierte Fachkräfte zu halten und neue Talente zu gewinnen.
In einer Zeit, in der Zentralbanken weltweit ihre Legitimität verteidigen müssen – etwa in Fragen der Inflation, der digitalen Währung oder der grünen Transformation – kann sich die EZB keine strukturellen Risse in der eigenen Organisation leisten. Sie muss interne Glaubwürdigkeit schaffen, um externe Autorität auszuüben.
Fazit: Warnsignal mit Handlungsauftrag
Die Umfrage unter den EZB-Mitarbeitern ist ein Weckruf. Nicht nur für die Personalverantwortlichen, sondern für die gesamte Führungsspitze der Zentralbank. Transparenz, Fairness und Partizipation dürfen nicht nur auf dem Papier stehen – sie müssen gelebte Realität sein.
Wenn die EZB auch künftig Vorbild sein will für Vertrauen in Institutionen, braucht sie mehr als geldpolitische Stabilität: Sie braucht eine Kultur, die auf echter Leistung, klaren Regeln und offener Kommunikation basiert. Nur dann kann sie ihre Rolle als unabhängige, moderne und zukunftsfähige Institution im europäischen System glaubhaft ausfüllen.

Ich glaube, dass Menschen, die sich ihrer Ziele und Werte bewusst werden, sorgenfreier leben.