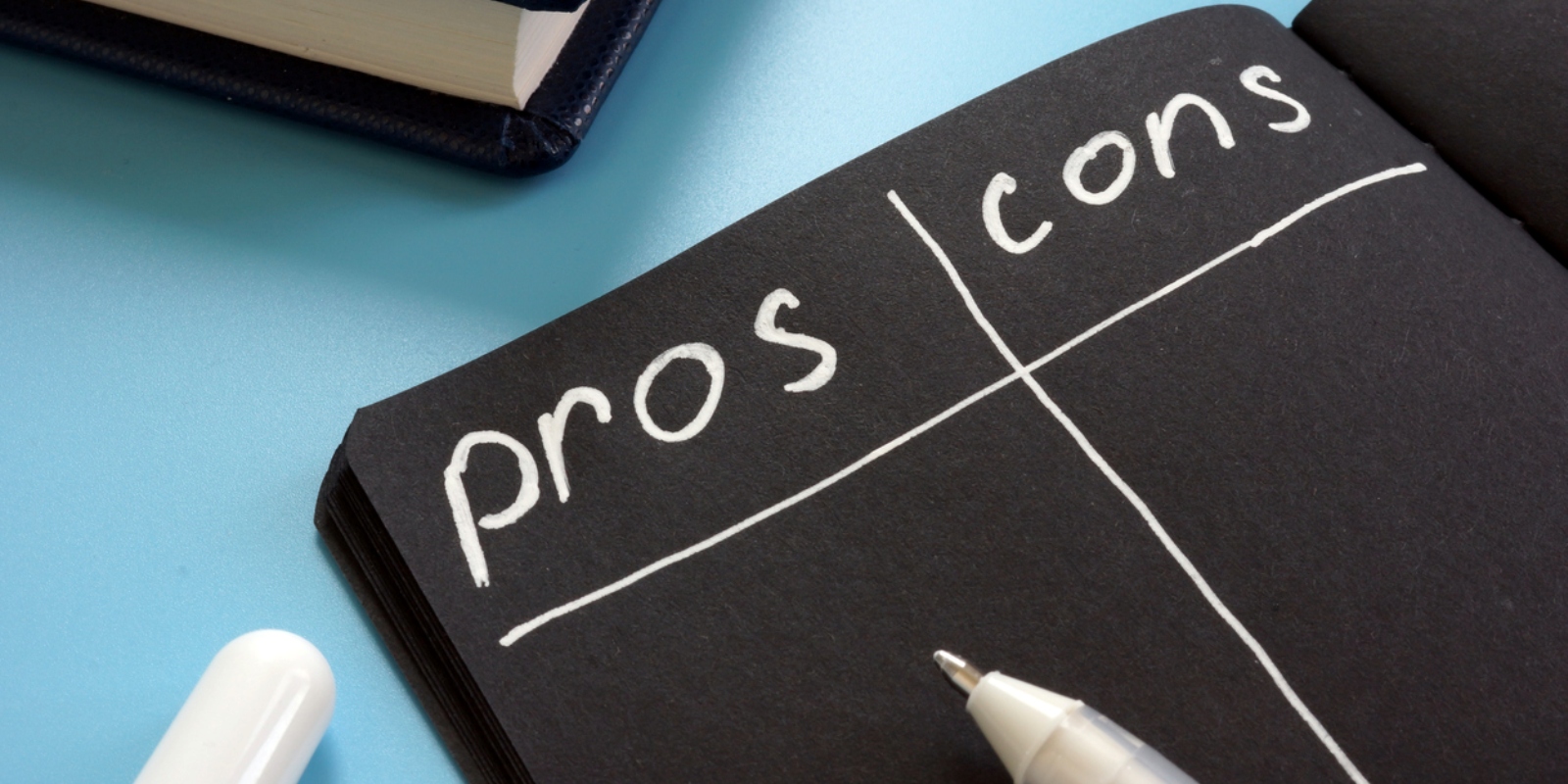Warum nominal nicht real ist Was ist die Geldillusion?
Ein unterschätzter Denkfehler mit realen Konsequenzen für Anleger und Verbraucher.
Die sogenannte Geldillusion beschreibt ein Phänomen der Verhaltensökonomie, bei dem Menschen nominale Größen – also Zahlenwerte in Geldeinheiten – fälschlicherweise mit realem Wert gleichsetzen. Ein typisches Beispiel: Ein Gehaltserhöhung von 3 % wird als Zuwachs empfunden, auch wenn die Inflation im gleichen Zeitraum ebenfalls 3 % oder höher beträgt. Die reale Kaufkraft hat sich in diesem Fall gar nicht verbessert – möglicherweise sogar verschlechtert.
Diese Denkverzerrung tritt nicht nur bei Konsumenten auf, sondern beeinflusst auch Entscheidungen von Anlegern, Arbeitnehmern und Politikern. Sie kann zu überzogenen Erwartungen, Fehlinvestitionen oder falscher Risikowahrnehmung führen. Die Geldillusion blendet die Wirkung von Inflation aus – und genau das macht sie so gefährlich.
Psychologische Ursprünge
Menschen denken in der Regel in nominalen Beträgen, weil diese sichtbar, greifbar und intuitiv verständlich sind. Wenn das Gehalt steigt oder die Zahl auf dem Konto wächst, entsteht subjektiv das Gefühl von Wohlstand. Die notwendige Abstraktion, zwischen „mehr Geld“ und „mehr Wert“ zu unterscheiden, fällt vielen schwer – vor allem, wenn Inflation nicht unmittelbar spürbar ist oder unregelmäßig auftritt.
Zudem werden relative Veränderungen wie ein „Plus 5 %“ oft emotional positiver bewertet als absolute Verluste – selbst wenn der reale Wertverlust höher ausfällt. Diese kognitive Verzerrung ist eng mit weiteren psychologischen Effekten wie dem sogenannten Framing oder dem Status-quo-Bias verknüpft.
Geldillusion in der Finanzberatung
Die Geldillusion ist ein klassisches Beispiel dafür, wie menschliche Wahrnehmung von ökonomischer Realität abweichen kann. Nominal bedeutet nicht real – und wer diesen Unterschied konsequent berücksichtigt, ist nicht nur besser gegen schleichende Entwertung gewappnet, sondern trifft auch robustere Anlageentscheidungen."
In der Anlageberatung kann die Geldillusion dazu führen, dass Kunden die reale Wertentwicklung ihrer Investments überschätzen. Eine Anleihe, die über mehrere Jahre hinweg nominal 2 % pro Jahr erwirtschaftet, scheint „sicher“ – verliert aber bei einer Inflationsrate von 3 % jährlich real an Wert. Wenn Berater und Kunden ausschließlich nominale Renditen betrachten, entsteht ein falsches Bild von Risiko und Ertrag.
Auch in der Altersvorsorge hat die Geldillusion gravierende Folgen. Wer sich ein Sparziel von 500.000 Euro für das Rentenalter setzt, muss bedenken, dass dieser Betrag in 30 Jahren – bei nur moderater Inflation – real erheblich weniger Kaufkraft bietet. Ohne entsprechende Anpassung der Planung droht eine empfindliche Versorgungslücke.
Makroökonomische Relevanz
Auf volkswirtschaftlicher Ebene wirkt sich die Geldillusion unter anderem auf Lohnverhandlungen, Konsumverhalten und Geldpolitik aus. Arbeitnehmer akzeptieren eher moderate nominale Lohnerhöhungen in Zeiten niedriger Inflation – selbst wenn sie real stagnieren. Das entlastet Unternehmen in Krisenzeiten, kann aber auch zu schleichender Ungleichheit führen.
Zentralbanken nutzen die Geldillusion bewusst oder unbewusst: Moderate Inflation senkt reale Lohnkosten und realen Schuldenstand, ohne dass nominelle Kürzungen durchgesetzt werden müssen. Das birgt politischen Sprengstoff – vor allem, wenn die öffentliche Wahrnehmung erst zeitverzögert auf reale Verluste reagiert.
Schutz vor der Geldillusion
box
Ein bewusster Umgang mit Inflation ist der wichtigste Schutz vor der Geldillusion.
Das gilt für Verbraucher wie für Anleger gleichermaßen:
- Nominale Renditen sollten immer inflationsbereinigt betrachtet werden.
- Finanzpläne und Sparziele müssen regelmäßig an die tatsächliche Kaufkraft angepasst werden.
- Bei der Altersvorsorge sollten reale Zielgrößen (z. B. „monatliche Kaufkraft in heutiger Währung“) statt bloßer Kontosummen im Vordergrund stehen.
Zudem kann finanzielle Bildung helfen, die Illusion zu durchbrechen.
Wenn Begriffe wie „realer Ertrag“, „inflationsbereinigter Zins“ oder „Kaufkraft“ selbstverständlich in die Beratung eingebettet sind, steigt die Chance auf nachhaltige Entscheidungen.
Fazit: Mehr sehen als Zahlen
Die Geldillusion ist ein klassisches Beispiel dafür, wie menschliche Wahrnehmung von ökonomischer Realität abweichen kann. Nominal bedeutet nicht real – und wer diesen Unterschied konsequent berücksichtigt, ist nicht nur besser gegen schleichende Entwertung gewappnet, sondern trifft auch robustere Anlageentscheidungen. Für Finanzberater, Investoren und Politik gilt deshalb gleichermaßen: Der nüchterne Blick auf die reale Kaufkraft ist der erste Schritt zu klügerem Umgang mit Geld.

Ich repariere Versicherungsverträge und Finanzdienstleistungen!