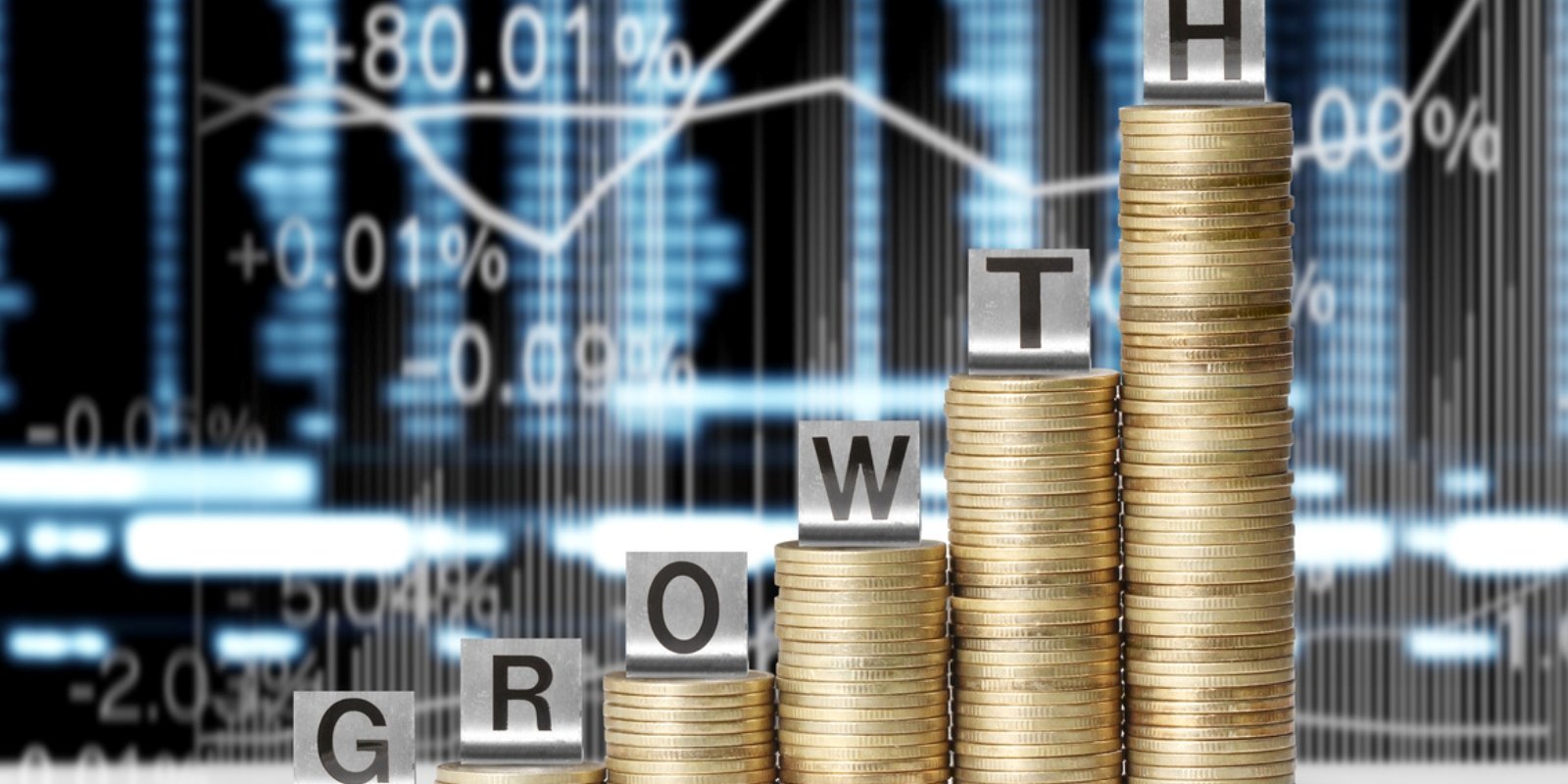Studie Wer erbt, arbeitet weniger
Wenn Vermögen den Anreiz verändert.
Erben gilt gemeinhin als Glücksfall – finanzielle Sicherheit ohne eigene Leistung. Doch neue Forschungsergebnisse aus der Schweiz werfen ein differenziertes Licht auf diese Vorstellung. Laut einer aktuellen Studie um den Ökonomen Marius Brülhart von der Universität Lausanne verringert ein Erbe deutlich die Bereitschaft zu arbeiten.
Die Untersuchung kommt zu dem Ergebnis, dass Erbschaften die volkswirtschaftliche Produktivität messbar beeinflussen. Für die Schweiz schätzen die Forscher die dadurch entgangene Arbeitsleistung auf rund zehn Milliarden Franken pro Jahr, etwa 1,1 Prozent des Bruttoinlandsprodukts.
Der ökonomische Hintergrund
Die Studie basiert auf umfangreichen Steuer- und Einkommensdaten über mehrere Jahre. Sie untersucht, wie sich das Arbeitsverhalten von Personen verändert, die plötzlich zu Vermögen kommen – etwa durch Erbschaften, Schenkungen oder größere Kapitalzuflüsse.
Das Ergebnis zeigt einen klaren Trend: Nach Erhalt einer Erbschaft sinkt die durchschnittliche Erwerbstätigkeit. Besonders ausgeprägt ist der Effekt bei Personen, deren Erbschaft ein Vielfaches ihres Jahreseinkommens beträgt. Sie reduzieren die Arbeitszeit, wechseln in weniger fordernde Tätigkeiten oder ziehen sich ganz aus dem Erwerbsleben zurück.
Die Forscher sprechen von einem klassischen „Vermögenseffekt“: Wenn Einkommen nicht mehr ausschließlich durch Arbeit entsteht, verliert Arbeit an Notwendigkeit.
Gesellschaftliche Folgen
box
Die wirtschaftlichen Auswirkungen sind beträchtlich.
In einer alternden Gesellschaft, in der immer mehr Vermögen vererbt wird, kann dieser Effekt strukturelle Konsequenzen haben.
Sinkende Erwerbsbeteiligung bedeutet:
- geringere Steuereinnahmen und Sozialbeiträge,
- wachsende Ungleichheit zwischen Erben und Nichterben,
- geringere Dynamik im Arbeitsmarkt.
Damit wird Erben zu einem gesamtgesellschaftlichen Thema – nicht nur zu einer privaten Frage der Lebensplanung.
Arbeitsmoral und soziale Balance
Die Ergebnisse berühren auch die Debatte über Leistung und Gerechtigkeit. Wenn große Vermögen die Erwerbsarbeit ersetzen, verändert sich das Verständnis von sozialem Beitrag und Wohlstand.
Brülhart und sein Team betonen, dass Erbschaften an sich kein Problem darstellen – wohl aber ihre ungleiche Verteilung und ihre Wirkung auf das Arbeitsangebot. Wer bereits über ausreichend Mittel verfügt, hat weniger ökonomischen Druck, sich am Arbeitsmarkt zu beteiligen. Für Volkswirtschaften mit ohnehin knappem Fachkräfteangebot kann das zum Risiko werden.
Mögliche politische Konsequenzen
Der Rückgang der Erwerbstätigkeit nach größeren Erbschaften ist kein Randphänomen, sondern ein volkswirtschaftlich messbarer Effekt."
Die Diskussion über Erbschafts- und Vermögenssteuern erhält durch die Studie neue Relevanz. In vielen Ländern, darunter auch in der Schweiz, werden Erbschaften nur moderat oder gar nicht besteuert.
Ökonomen argumentieren, dass eine höhere Besteuerung großer Vermögen nicht nur Umverteilung, sondern auch Arbeitsanreize stärken könnte. Kritiker halten dagegen, dass Steuern auf Erbschaften den Kapitalaufbau bestrafen und Familienunternehmen gefährden.
Der Befund der Lausanner Forscher liefert jedoch einen nüchternen Hinweis: Erbschaften wirken nicht neutral – sie beeinflussen Verhalten und Produktivität.
Ein langfristiger Trend
Die Entwicklung hat auch eine demografische Dimension. In den kommenden Jahrzehnten wird ein historisch hoher Vermögenstransfer stattfinden, wenn die Babyboomer-Generation ihre Ersparnisse vererbt. Die Summe der Erbschaften könnte in vielen westlichen Ländern das Mehrfache der jährlichen Wirtschaftsleistung betragen.
Die Frage, wie Gesellschaften damit umgehen, wird zur ökonomischen Schlüsselfrage: Wie lassen sich individuelle Freiheit und kollektive Leistungsfähigkeit in Einklang bringen?
Fazit
Die Studie aus Lausanne zeigt, dass Erben nicht nur Vermögen, sondern auch Verhalten verändert. Der Rückgang der Erwerbstätigkeit nach größeren Erbschaften ist kein Randphänomen, sondern ein volkswirtschaftlich messbarer Effekt.
Die Herausforderung liegt darin, Wohlstand und Motivation zugleich zu erhalten. Eine Gesellschaft, die hohe Vermögen weitergibt, muss auch Wege finden, Leistungsanreize und soziale Balance zu sichern.

Ich repariere Versicherungsverträge und Finanzdienstleistungen!