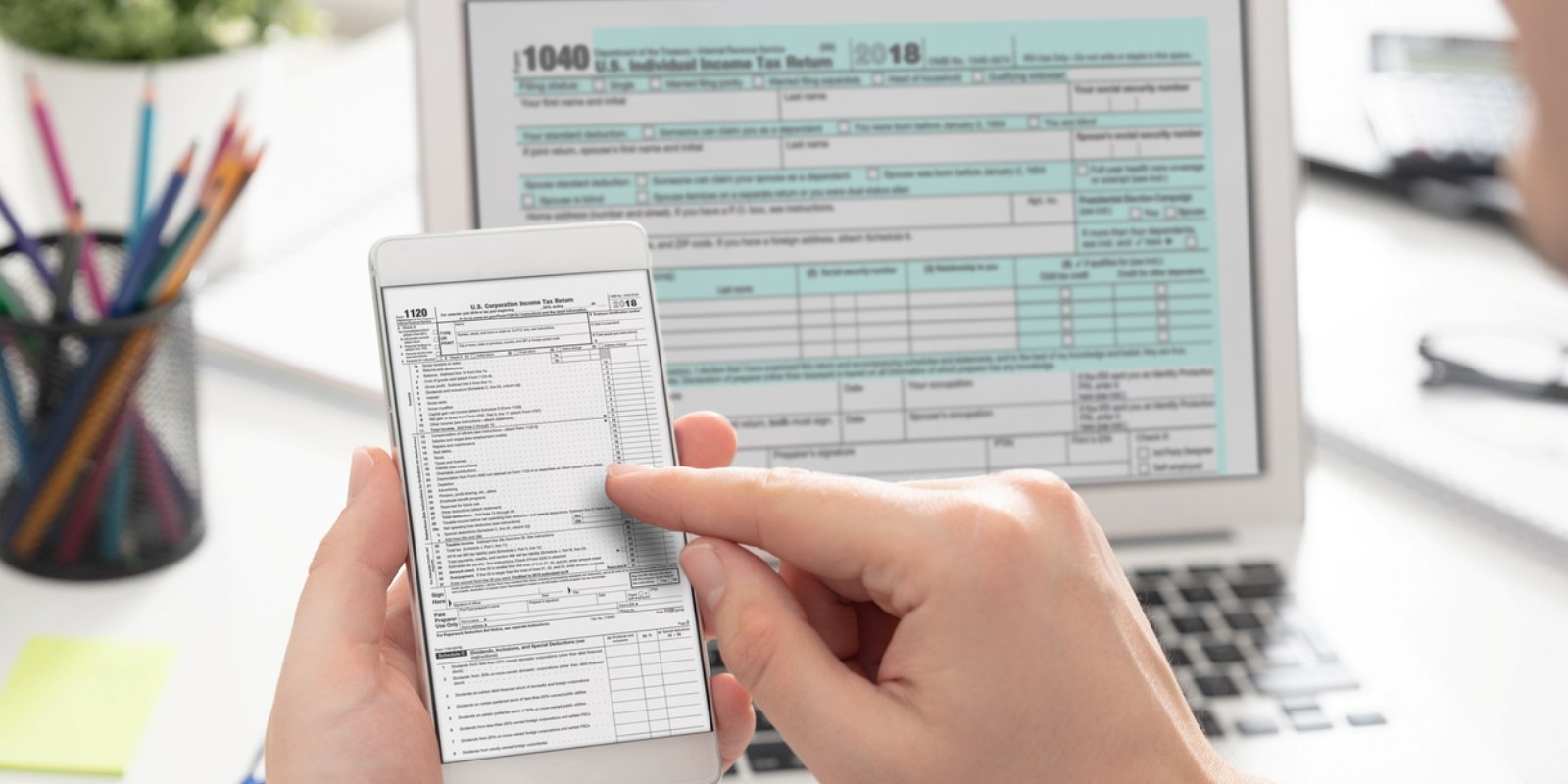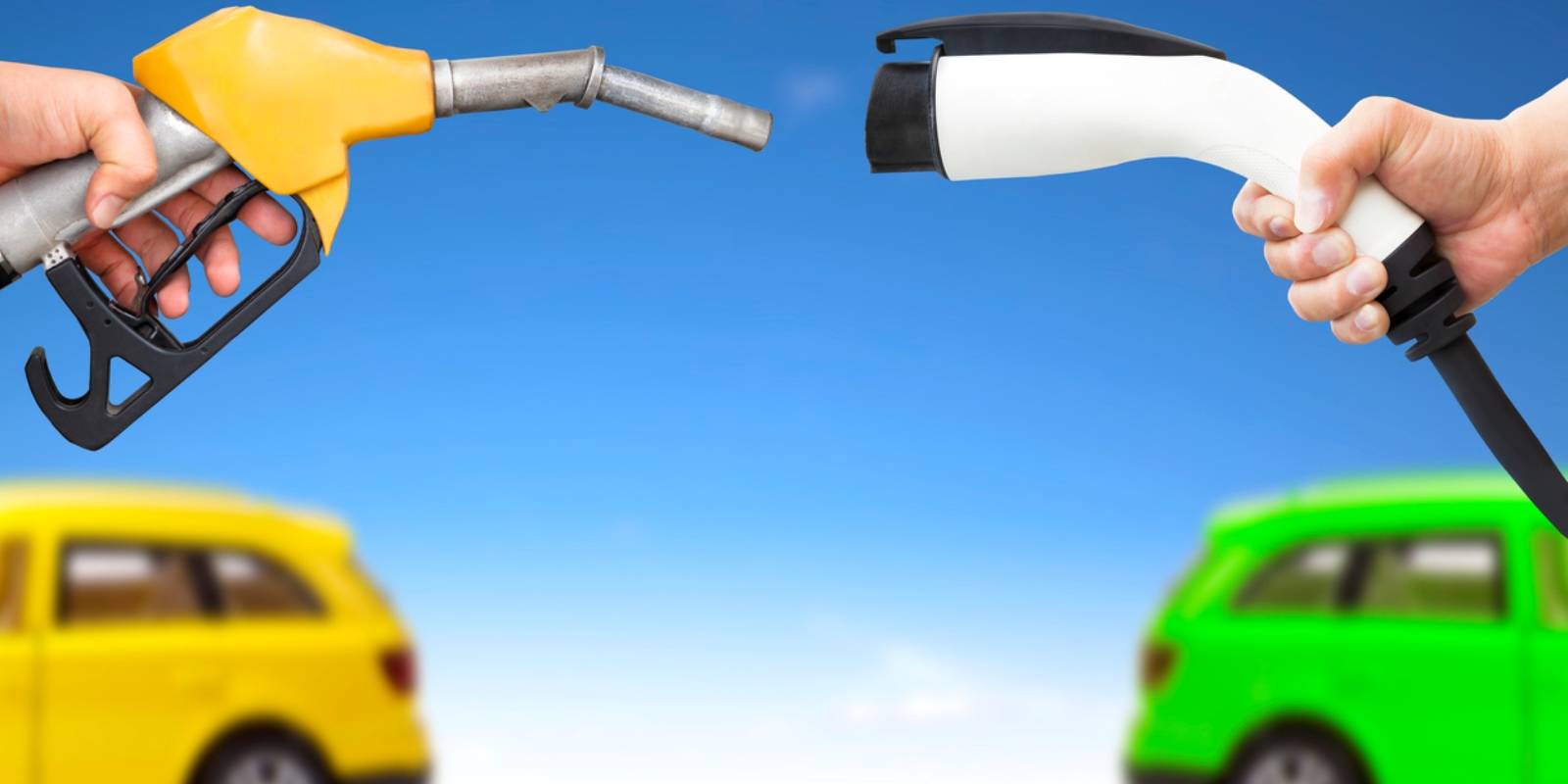Historische Tech-Konzentration Dotcom-Blase 2.0?
Nicht jeder Boom ist eine Blase – aber jede Blase beginnt mit einem Boom.
Die US-Börsen eilen von Rekord zu Rekord, und wieder einmal sind es die großen Technologiewerte, die den Takt angeben. Apple, Microsoft, Nvidia, Alphabet, Amazon, Meta und Tesla – die „Magnificent Seven“ – dominieren den S&P 500 in einem Ausmaß, das selbst erfahrene Marktbeobachter staunen lässt.
Gemeinsam stehen sie inzwischen für rund 40 Prozent der Marktkapitalisierung des Leitindex – ein historisch beispielloser Wert.
Die Parallelen zur Jahrtausendwende, zur legendären Dotcom-Blase, drängen sich auf: Damals trieben überzogene Erwartungen an das Internet Aktienkurse in schwindelerregende Höhen – bis der Absturz kam. Doch diesmal, so argumentieren Analysten von Columbia Threadneedle, sei das Bild komplexer. Zwar bestehe eine gefährliche Konzentration, doch die Substanz der heutigen Tech-Giganten sei real.
Die Macht der „Magnificent Seven“
box
Noch nie zuvor in der modernen Börsengeschichte trugen so wenige Unternehmen so viel zur Gesamtperformance eines Index bei.
Im Jahr 2024 stammt mehr als die Hälfte der Kursgewinne des S&P 500 allein von den sieben Tech-Schwergewichten.
Das hat mehrere Konsequenzen:
- Der Index spiegelt nicht mehr die Breite der US-Wirtschaft wider, sondern eine hochkonzentrierte Tech-Elite.
- Kleine Kursbewegungen einzelner Werte können ganze Märkte bewegen.
- Das Risiko von Überbewertungen wächst – vor allem, wenn Investoren beginnen, Wachstum als selbstverständlich anzusehen.
Columbia Threadneedle spricht von einer „historisch einmaligen Verzerrung der Marktstruktur“, die zugleich Stärke und Verletzlichkeit bedeute.
Parallelen zur Dotcom-Blase – und ihre Grenzen
Die Vergleichsmechanik ist verführerisch: Auch im Jahr 2000 waren Technologieaktien die unangefochtenen Stars. Auch damals glaubte man an eine Revolution – das Internet als Zukunftsversprechen.
Doch es gibt entscheidende Unterschiede.
Erstens: Die heutigen Marktführer schreiben Milliardengewinne. Microsoft, Apple und Alphabet verfügen über solide Bilanzen, hohe Cashflows und Preissetzungsmacht.
Zweitens: Die technologischen Trends – Künstliche Intelligenz, Cloud-Computing, Digitalisierung – sind bereits Realität, keine Vision.
Drittens: Die Kapitalstruktur hat sich verändert. Während in der Dotcom-Ära spekulative Start-ups mit kaum Umsatz Milliardenbewertungen erreichten, beruhen die heutigen Bewertungen auf tatsächlicher Profitabilität.
Kurz gesagt: Der Markt mag heiß gelaufen sein – aber nicht leer.
Wo die Risiken wirklich liegen
Die Portfoliomanager von Columbia Threadneedle warnen jedoch vor zweiten Effekten:
Nicht die fundamentale Schwäche der Unternehmen selbst, sondern die Marktdynamik könne zur Gefahr werden.
- Überkonzentration: Je stärker Indizes auf wenige Titel fokussiert sind, desto anfälliger werden sie für Korrekturen.
- Passive Anlageflüsse: Milliarden in ETFs und Indexfonds verstärken diesen Trend, da sie automatisch die größten Werte nachkaufen.
- Psychologische Effekte: Anleger gewöhnen sich an stetige Gewinne – bis ein einzelner Rückschlag das Vertrauen erschüttert.
Die Folge könnte eine „Systemblase durch Struktureffekt“ sein: kein irrationaler Hype wie 2000, sondern eine stille Verwundbarkeit durch Kapitalflüsse und Indexmechanik.
Fundamentale Stärke trifft auf Bewertungsstress
Nicht jeder Boom ist eine Blase – aber jede Blase beginnt mit einem Boom.
Wer die Mechanismen versteht, kann vom technologischen Aufschwung profitieren, ohne ihm blind zu verfallen."
Bewertungskennzahlen deuten tatsächlich auf Überhitzung: Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) des US-Tech-Sektors liegt deutlich über dem historischen Durchschnitt. Nvidia beispielsweise wird mit einem Vielfachen gehandelt, das selbst optimistische Wachstumsprognosen voraussetzt.
Doch zugleich verdienen die großen Tech-Konzerne heute real Geld mit realen Produkten.
Das unterscheidet sie von der Dotcom-Generation. Viele von ihnen haben sich in systemrelevante Infrastrukturplayer verwandelt – ihre Software, Cloud-Dienste oder Plattformen sind zentrale Bestandteile der Weltwirtschaft.
Die Schlussfolgerung der Experten lautet daher: Es gibt Blasenrisiken, aber keine klassische Spekulationsblase.
Chancen in der Schattenzone
Interessant ist, dass die Dominanz der „Magnificent Seven“ auch Chancen für aktive Anleger schafft.
Denn während die Schwergewichte die Indizes dominieren, bleiben viele mittelgroße Tech-Unternehmen, Softwareanbieter und Halbleiterzulieferer unterbewertet.
Columbia Threadneedle sieht hier ein „zweites Band des Tech-Booms“: Nicht die großen Plattformen, sondern die spezialisierte Infrastruktur dahinter – etwa in den Bereichen KI-Sicherheit, Rechenzentren oder Halbleiterarchitektur – könnten die nächste Wachstumswelle tragen.
Mit anderen Worten: Wer über die offensichtlichen Gewinner hinausblickt, findet echte Diversifikation – auch im Technologiesektor.
Fazit
Die Angst vor einer neuen Dotcom-Blase ist verständlich, aber nicht gerechtfertigt. Zwar erinnert die Marktkonzentration an die späten 1990er Jahre, doch die wirtschaftliche Substanz der führenden Unternehmen ist heute unvergleichlich höher.
Dennoch ist Vorsicht geboten:
- Der Markt hängt stärker als je zuvor an wenigen Titeln.
- Korrekturen können sich schnell potenzieren.
- Diversifikation ist das beste Gegenmittel gegen Herdenverhalten.
Die Lehre lautet: Nicht jeder Boom ist eine Blase – aber jede Blase beginnt mit einem Boom.
Wer die Mechanismen versteht, kann vom technologischen Aufschwung profitieren, ohne ihm blind zu verfallen.
Der Technologiesektor bleibt damit das, was er seit Jahrzehnten ist: Motor und Risiko zugleich – die Bühne, auf der Zukunft und Übertreibung Hand in Hand gehen.
Erst der Mensch, dann das Geschäft