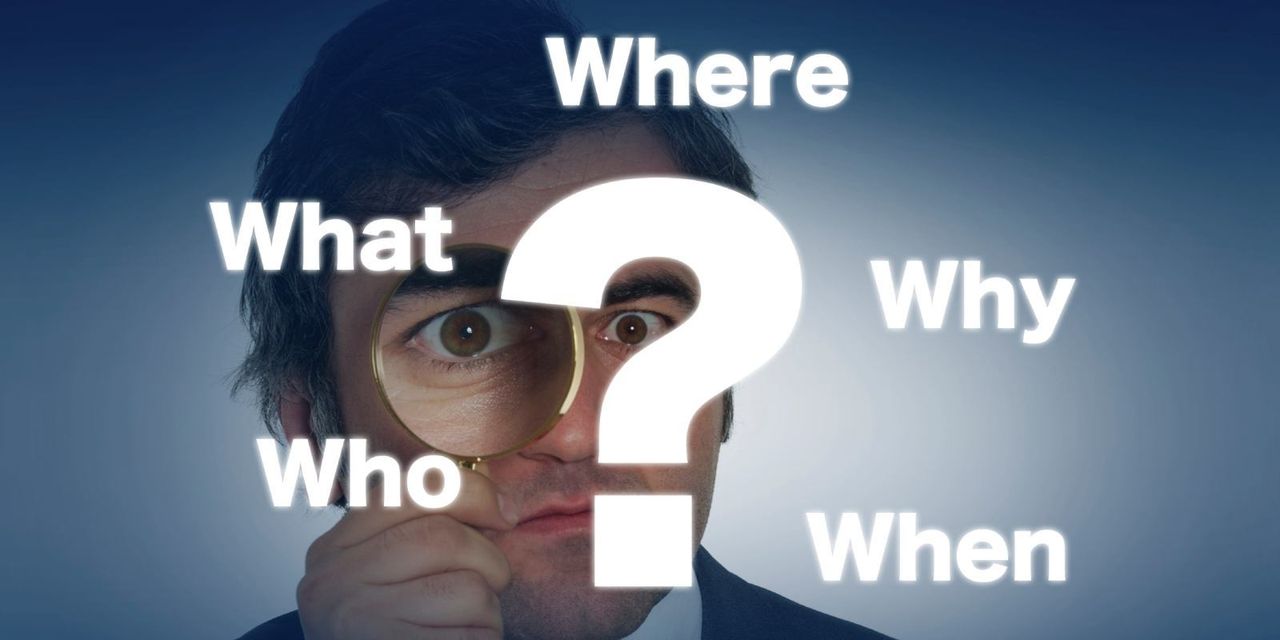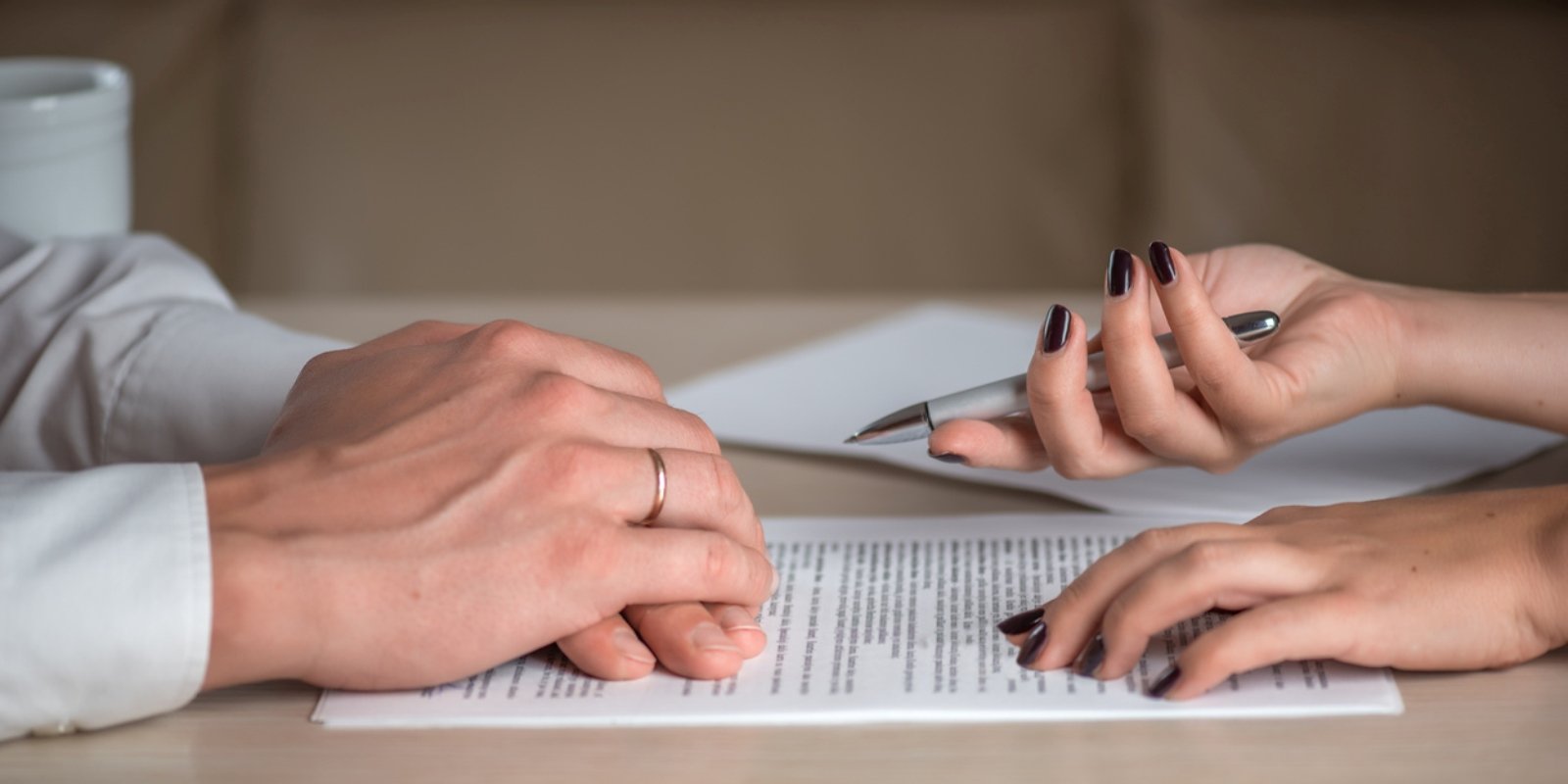Wer hat Zugriff? Elektronische Patientenakte
Die elektronische Patientenakte (ePA) soll das deutsche Gesundheitssystem digitalisieren und die medizinische Versorgung effizienter und transparenter gestalten.
Die elektronische Patientenakte (ePA) ermöglicht es Versicherten, medizinische Daten zentral zu speichern und bequem mit Ärztinnen und Ärzten zu teilen. Die ePA wird schrittweise eingeführt, und in ersten Bundesländern können Versicherte sie bereits testen und nutzen. Doch es gibt Bedenken hinsichtlich Datensicherheit, Zugriffsrechten und der Datenlöschung.
1. Was ist die elektronische Patientenakte (ePA)?
box
Die elektronische Patientenakte (ePA) ist eine digitale Sammlung von medizinischen Dokumenten und Informationen einer versicherten Person. Sie dient als zentrales Register für gesundheitsbezogene Daten und soll den Informationsaustausch im Gesundheitssystem verbessern.
a) Ziel und Zweck der ePA
- Zentrale Speicherung und Verfügbarkeit: Alle relevanten Gesundheitsdaten einer Person sollen an einem zentralen Ort gespeichert und jederzeit abrufbar sein.
- Effizientere Behandlung: Ärzte, Zahnärzte und Therapeuten können auf relevante Informationen zugreifen, was Doppeluntersuchungen und Fehldiagnosen vermeiden soll.
- Selbstbestimmung der Patienten: Versicherte sollen selbst entscheiden, wer welche Daten sehen darf und wie lange diese gespeichert bleiben.
b) Gesetzliche Grundlage und Einführung
- Digitale-Versorgung-Gesetz (DVG): Die Einführung der ePA wurde durch das Digitale-Versorgung-Gesetz in Deutschland festgelegt.
- Schrittweise Einführung: Seit 2021 wird die ePA schrittweise ausgerollt und weiterentwickelt, mit dem Ziel, bis 2025 flächendeckend verfügbar zu sein.
2. Welche Daten werden in der ePA gespeichert?
Die ePA ermöglicht die Speicherung unterschiedlicher Gesundheitsdaten, die für die medizinische Versorgung relevant sind. Versicherte können selbst entscheiden, welche Informationen hochgeladen und gespeichert werden.
a) Mögliche Inhalte der ePA
- Arztbriefe und Befunde: Dokumente von Fachärzten und Hausärzten, inklusive Diagnosen und Therapieempfehlungen.
- Laborergebnisse: Blutwerte, Bildgebungsergebnisse (z. B. Röntgenbilder) und andere Diagnostikdaten.
- Impfpass und Vorsorgeuntersuchungen: Impfstatus, Vorsorgeuntersuchungen und Früherkennungsuntersuchungen.
- Medikationsplan: Aktuelle und vergangene Medikamente, Dosierungen und Wechselwirkungen.
- Notfalldaten: Allergien, Unverträglichkeiten und chronische Erkrankungen, die im Notfall relevant sein können.
- Arzneimitteldokumentation: Verordnungen und Apothekenbelege.
- Krankheitsverläufe und Therapieberichte: Verläufe chronischer Erkrankungen und Therapiepläne.
b) Freiwilligkeit und Kontrolle durch Versicherte
- Freiwillige Nutzung: Die Nutzung der ePA ist freiwillig. Versicherte entscheiden selbst, ob sie eine elektronische Patientenakte anlegen und welche Daten gespeichert werden sollen.
- Datenhoheit und Kontrolle: Versicherte haben volle Kontrolle über ihre Daten und können Dokumente hinzufügen, löschen oder freigeben.
3. Wer hat Zugriff auf die elektronische Patientenakte?
Die elektronische Patientenakte ist ein wichtiger Schritt zur Digitalisierung des Gesundheitssystems. Sie ermöglicht effiziente Behandlungen und verbessert die Versorgung. Doch der Erfolg hängt maßgeblich von Datensicherheit, Transparenz und Akzeptanz der Versicherten ab."
Der Zugriff auf die ePA erfolgt nach dem „Schlüssel-Schloss-Prinzip“ und unterliegt strengen Datenschutzbestimmungen. Versicherte können individuell festlegen, wer Zugriff hat und welche Daten eingesehen werden dürfen.
a) Zugriffsrechte und Freigaben
- Versicherte selbst: Nur Versicherte haben uneingeschränkten Zugriff auf ihre ePA und können Daten verwalten, hinzufügen und löschen.
- Ärzte und medizinisches Personal: Zugriffsrechte werden einzeln und zeitlich begrenzt durch die Versicherten freigegeben. Ärzte benötigen eine Zugriffsberechtigung und können nur die freigegebenen Dokumente einsehen.
- Apotheken und Therapeuten: Auch Apotheken und Therapeuten können Zugriff erhalten, etwa um Medikamentenpläne zu aktualisieren oder Therapieberichte einzusehen.
- Krankenkassen: Krankenkassen haben keinen direkten Zugriff auf medizinische Daten, sondern nur auf Verwaltungsdaten, die zur Abrechnung und Verwaltung erforderlich sind.
b) Zugriffsverwaltung und Zeitbegrenzung
- Individuelle Freigaben: Versicherte können individuell festlegen, welche Person auf welche Dokumente zugreifen darf.
- Zeitlich begrenzter Zugriff: Der Zugriff kann zeitlich begrenzt werden, z. B. nur für eine Behandlung oder Untersuchung. Nach Ablauf der Freigabezeit erlischt der Zugriff automatisch.
- Protokollierung des Zugriffs: Jeder Zugriff auf die ePA wird protokolliert und ist für die Versicherten jederzeit einsehbar, um Transparenz und Sicherheit zu gewährleisten.
4. Datensicherheit und Datenschutz
Datensicherheit und Datenschutz sind zentrale Aspekte der ePA, um Vertrauen und Akzeptanz bei den Versicherten zu schaffen. Die gespeicherten Gesundheitsdaten sind besonders sensibel und erfordern höchste Sicherheitsstandards.
a) Sicherheitsmaßnahmen und Verschlüsselung
- Ende-zu-Ende-Verschlüsselung: Alle Daten werden verschlüsselt gespeichert und nur lokal auf den Endgeräten entschlüsselt, um Hackerangriffe zu verhindern.
- Zwei-Faktor-Authentifizierung: Der Zugriff auf die ePA erfolgt nur mit starker Authentifizierung, etwa durch PIN und TAN oder biometrische Merkmale.
- Sichere Server und Cloud-Lösungen: Die Daten werden auf hochsicheren Servern in Deutschland gespeichert, die den strengen Vorgaben der DSGVO entsprechen.
b) Löschung und Datenhoheit
- Löschung von Daten: Versicherte können jederzeit Daten löschen oder die gesamte ePA auflösen, sodass alle gespeicherten Informationen unwiderruflich gelöscht werden.
- Keine Weitergabe an Dritte: Eine Weitergabe an Dritte (z. B. Arbeitgeber oder Versicherungen) ist ohne ausdrückliche Zustimmung der Versicherten nicht zulässig.
5. Herausforderungen und Ausblick
Die elektronische Patientenakte bietet enorme Vorteile für die medizinische Versorgung, doch es gibt auch Herausforderungen:
- Akzeptanz und Vertrauen: Datenschutzbedenken führen zu Skepsis. Transparente Informationen sind notwendig, um Vertrauen zu schaffen.
- Technische Herausforderungen: Kompatibilität und Interoperabilität zwischen unterschiedlichen Systemen müssen gewährleistet sein.
- Rechtliche Rahmenbedingungen: Klare gesetzliche Regelungen zu Datenschutz und Zugriffsrechten sind entscheidend.
Fazit
Die elektronische Patientenakte ist ein wichtiger Schritt zur Digitalisierung des Gesundheitssystems. Sie ermöglicht effiziente Behandlungen und verbessert die Versorgung. Doch der Erfolg hängt maßgeblich von Datensicherheit, Transparenz und Akzeptanz der Versicherten ab. Mit strengen Sicherheitsstandards und umfassender Aufklärung kann die ePA zur Erfolgsgeschichte werden.
Freiräume schaffen für ein gutes Leben.