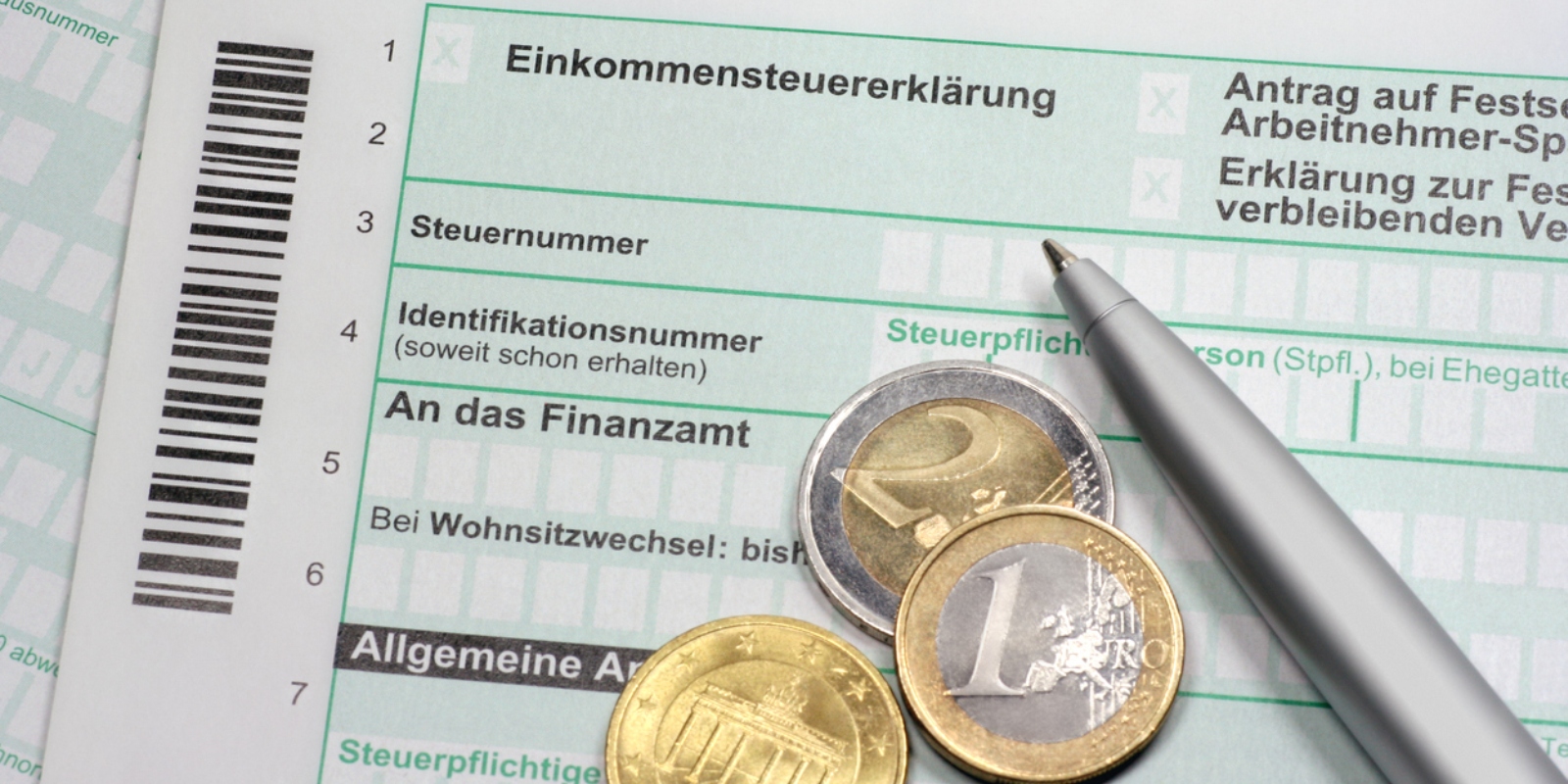Wirtschaftsdenker: Harry Markowitz (1927–2023) Moderne Portfoliotheorie und Diversifikation
Viele Einzelwerte, aber ein einziges Depot.
Wer ein Depot führt, kennt das Gefühl: Eine Aktie läuft stark, eine andere bricht ein. Oft richtet sich der Blick auf jeden Titel einzeln. Die zentrale Frage lautet dann: „Welche Aktie ist die richtige?“ Markowitz dreht diese Sicht um. Für ihn ist wichtig, wie das gesamte Depot schwankt – nicht, wie sich jeder Einzelwert isoliert verhält. Daraus entsteht die moderne Portfoliotheorie. Weitere Aphorismen und Konzepte sind hier.
Das Konzept im Kern: Risiko durch Mischung steuern
Die Grundidee lässt sich einfach formulieren: Entscheidend ist nicht nur, wie riskant einzelne Anlagen sind, sondern wie sie sich gemeinsam verhalten.
Wichtige Punkte:
- Zwei Wertpapiere, die für sich genommen stark schwanken, können zusammen ein ruhigeres Depot ergeben, wenn sie sich nicht gleichzeitig nach oben oder unten bewegen.
- Wenn eine Anlage steigt, während eine andere fällt, gleichen sich Schwankungen teilweise aus.
Markowitz zeigt damit:
Klug gewählte Diversifikation kann das Risiko senken, ohne die Renditeaussichten zu verschlechtern."
- Risiko ist eine Eigenschaft des Portfolios, nicht nur der Einzelwerte.
- Für ein gegebenes Risikoniveau lässt sich eine bessere erwartete Rendite erreichen, wenn die Mischung sinnvoll gewählt ist.
- Es gibt eine Menge von Portfolios, die für ein bestimmtes Risiko die bestmögliche erwartete Rendite bieten. Diese Menge kann man sich als „Effizienzgrenze“ vorstellen.
Die Theorie misst Risiko über Schwankungen im Zeitverlauf. Sie unterscheidet nicht zwischen „guten“ Schwankungen (Gewinne) und „schlechten“ (Verluste), sondern betrachtet die Bewegung insgesamt. Nicht berücksichtigt sind Verhaltensmuster, Panikreaktionen oder extreme Ausnahmesituationen.
Trotz dieser Vereinfachungen bleibt die Kernbotschaft klar: Wer nur auf Einzeltitel starrt, übersieht das Risikoprofil des Ganzen.
Der Kopf hinter der Idee: Markowitz und die Depotbrille
Harry Markowitz war ein US-amerikanischer Ökonom, der in den 1950er-Jahren einen neuen Blick auf Wertpapierdepots entwickelte. Er betrachtete das Portfolio ähnlich wie ein Ingenieur ein System: nicht als Sammlung an Einzelteilen, sondern als Ganzes mit eigenen Eigenschaften.
Sein Beitrag bestand darin:
- Risiko und Rendite gemeinsam zu denken.
- nicht nur einzelne Anlagen zu optimieren,
- sondern das Portfolio als Einheit zu modellieren.
Damit legte er einen Grundstein für viele spätere Entwicklungen in der Finanzökonomie. Die Idee, Risiko über Streuung und Zusammenhänge zu fassen, wurde Standard. Später erhielt Markowitz dafür den Wirtschaftsnobelpreis.
Bedeutung und Grenzen heute
box
Die Grundgedanken von Markowitz sind heute in vielen Angeboten enthalten, oft ohne dass sein Name erwähnt wird.
Dazu gehören zum Beispiel:
- Mischfonds, die bewusst verschiedene Anlageklassen kombinieren.
- ETF-Strategien, die nach festen Quoten Regionen und Branchen mischen.
- Vermögensverwaltungen, die Risikoprofile über ganze Depots definieren, nicht über einzelne Produkte.
Gleichzeitig wird deutlich, wo die Theorie an Grenzen stößt:
- In schweren Krisen bewegen sich viele Anlagen plötzlich doch in die gleiche Richtung. Diversifikation wirkt schwächer, als die historische Statistik vermuten ließ.
- Die Messung von Risiko über reine Schwankungen erfasst nicht alle Risiken, etwa Liquiditätsengpässe oder sehr seltene, aber heftige Ereignisse.
- Vergangenheitsdaten sind nur ein begrenzter Anhaltspunkt für zukünftige Zusammenhänge.
Trotzdem bleibt ein wesentlicher Satz bestehen: Ein zu stark gebündeltes Depot trägt oft mehr Risiko, als für das angestrebte Renditeziel nötig wäre.
Fazit und Merksätze
Die moderne Portfoliotheorie von Markowitz verschiebt den Blick: Weg vom einzelnen Wert, hin zum Gesamtbild des Depots. Risiko wird als Eigenschaft der Mischung verstanden. Das macht die Anlageentscheidung weniger zu einer Suche nach dem „einen richtigen Titel“, und mehr zu einer Frage der Struktur.
Drei Merksätze:
- Entscheidend ist, wie Anlagen zusammenwirken, nicht nur, wie riskant sie einzeln erscheinen.
- Klug gewählte Diversifikation kann Risiko senken, ohne die Renditeaussichten zu verschlechtern.
- Die Theorie liefert einen klaren Rahmen, ersetzt aber nicht die Prüfung, wie stabil Zusammenhänge in zukünftigen Marktphasen wirklich sind.
Freiräume schaffen für ein gutes Leben.