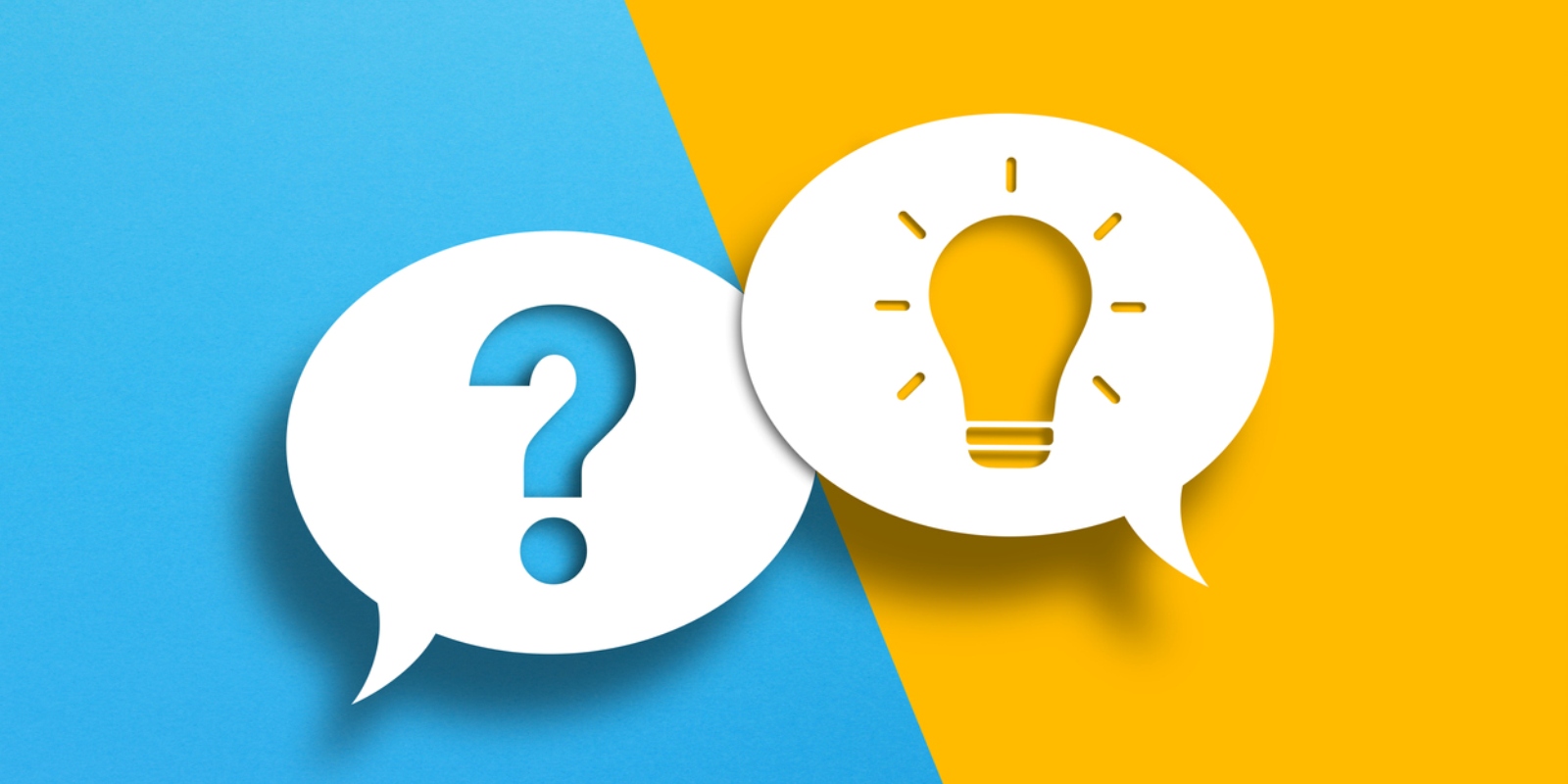Creditreform Insolvenzen steigen spürbar
Die europäische Wirtschaft ringt mit den Folgen multipler Krisen. Die Nachwirkungen der Corona-Pandemie, anhaltende geopolitische Spannungen, gestiegene Zinsen und schwächelnde Binnenkonjunktur hinterlassen sichtbare Spuren – insbesondere bei kleinen und mittleren Unternehmen. Der aktuelle Creditreform-Insolvenzreport zeigt nun mit Zahlen, was sich seit Monaten in Wirtschaftsdaten und Stimmungsumfragen andeutet: Die Unternehmensinsolvenzen in Europa steigen so stark wie seit einem Jahrzehnt nicht mehr.
Besonders stark betroffen ist die Baubranche, die in vielen Ländern als Frühindikator für konjunkturelle Wendepunkte gilt. Doch auch im Handel, im produzierenden Gewerbe und in Teilen der Dienstleistungswirtschaft sind die Signale eindeutig: Die Widerstandskraft vieler Betriebe ist erschöpft, die Anpassungslast der vergangenen Jahre war zu hoch. Das Insolvenzgeschehen wird damit zum Seismograf einer tiefgreifenden wirtschaftlichen Erschöpfung.
Die Zahlen im Überblick: Höchster Stand seit 2013
box
Laut dem aktuellen Report der Wirtschaftsauskunftei Creditreform ist die Zahl der Unternehmensinsolvenzen in Europa im Vergleich zum Vorjahr deutlich gestiegen.
Für das Gesamtjahr 2024 meldeten die Analysten einen Anstieg von rund 20 Prozent, wobei die Dynamik von Land zu Land unterschiedlich ausfällt.
Damit erreicht das Insolvenzgeschehen den höchsten Stand seit dem Jahr 2013, einem Zeitpunkt, der noch stark von den Nachwirkungen der Finanzkrise geprägt war.
Was diese Entwicklung besonders ernst macht: Sie betrifft nicht nur einzelne Staaten oder Sektoren, sondern zieht sich wie ein roter Faden durch nahezu alle großen europäischen Volkswirtschaften – mit besonderer Konzentration auf strukturell verwundbare Branchen.
Baubranche im freien Fall – das Ende eines jahrzehntelangen Booms?
In fast allen untersuchten Ländern gilt die Bauwirtschaft als der am stärksten betroffene Sektor. Das hat mehrere Gründe, die sich in ihrer Wirkung gegenseitig verstärken. Erstens sind die Baupreise durch Material- und Lohnkosten stark gestiegen, was laufende Projekte belastet und Ausschreibungen unattraktiver macht. Zweitens wirken die gestiegenen Zinsen direkt auf die Finanzierung von Immobilienprojekten, sowohl im privaten als auch im gewerblichen Bereich. Drittens ist die Nachfrage in vielen Regionen eingebrochen – nicht zuletzt, weil sich Bauherren und Investoren angesichts der Unsicherheit zurückhalten oder Projekte verschieben.
Infolgedessen geraten viele Bauunternehmen, insbesondere kleine und mittelgroße Anbieter, in akute Liquiditätsengpässe. Die Auftragsbücher sind zwar oft noch gefüllt, aber die Marge reicht nicht mehr, um laufende Kosten zu decken. Besonders dramatisch ist die Situation in Ländern, in denen die Immobilienpreise bereits hoch waren – etwa in Deutschland, den Niederlanden oder Österreich. Dort verschärft sich der Druck durch politische Unsicherheit und verschleppte Genehmigungsverfahren zusätzlich.
Weitere Krisenverlierer: Handel, Gastronomie und Dienstleistung
Auch der Einzelhandel zählt zu den Verlierern der aktuellen Entwicklung. Neben gestiegenen Betriebskosten kämpfen viele Händler mit einer nachlassenden Konsumlust, die durch Inflation und Unsicherheit verstärkt wird. Vor allem im stationären Bereich, der sich noch immer nicht vollständig vom pandemiebedingten Strukturbruch erholt hat, zeigen sich Insolvenzen mittlerweile auch bei ehemals etablierten Marken.
In der Gastronomie kommt ein weiterer Faktor hinzu: der Fachkräftemangel. Viele Betriebe finden trotz gestiegener Löhne kein geeignetes Personal mehr, gleichzeitig sinkt die Auslastung, weil Verbraucher zunehmend sparen. Selbst in touristisch attraktiven Regionen ist das Geschäftsmodell vieler kleiner Betriebe kaum noch tragfähig.
Bei den dienstleistungsnahen Gewerben wie Reinigungsdiensten, Sicherheitsfirmen oder Agenturen für temporäre Arbeitskräfte wirken sich insbesondere die Lohnsteigerungen und gestiegene Sozialabgaben aus. Die Kunden sind oft selbst wirtschaftlich unter Druck – entsprechend niedrig ist die Preissensibilität.
Ländervergleich: Wo der Druck am höchsten ist
Europa steckt mitten in einer Phase schleichender wirtschaftlicher Erschöpfung. Die steigenden Insolvenzen sind mehr als eine Zahl – sie sind ein Indikator für den schwindenden Puffer vieler Unternehmen, für die Risiken einer kreditfinanzierten Wirtschaft in Zeiten steigender Zinsen und für die Grenzen politischer Hilfsmaßnahmen."
Auch wenn alle großen Volkswirtschaften Europas betroffen sind, zeigt der Creditreform-Report regionale Unterschiede. Besonders hoch ist die Insolvenzdynamik aktuell in Deutschland, Frankreich und Großbritannien. In Deutschland trifft es die besonders mittelständisch geprägten Branchen, während Frankreich mit einem Rückstau von pandemiebedingt verschobenen Insolvenzen zu kämpfen hat. In Großbritannien wirken sich Brexit-Folgen, Energiepreise und Finanzierungskonditionen zugleich belastend aus.
Relativ stabil zeigen sich Länder wie Schweden, Dänemark oder die Schweiz, wo die Kapitaldecke vieler Unternehmen traditionell etwas robuster ist und die staatliche Unterstützung während der Krisenphasen differenzierter griff.
Ein bemerkenswerter Punkt: In Südeuropa, etwa in Spanien oder Italien, ist der Anstieg der Insolvenzen zwar vorhanden, aber weniger stark ausgeprägt. Dies liegt teils an verzögerten juristischen Verfahren, teils an einer vergleichsweise höheren Resilienz gegenüber wirtschaftlicher Unsicherheit, die aus früheren Krisen herrührt.
Die strukturelle Dimension: Was der Anstieg wirklich bedeutet
Die steigenden Insolvenzzahlen sind nicht nur ein Ausdruck konjunktureller Schwäche, sondern auch Symptom eines tiefgreifenden strukturellen Wandels, der sich in den letzten Jahren beschleunigt hat. Die Krise wirkt dabei wie ein Katalysator: Unternehmen, die bereits vor den aktuellen Belastungen ein fragiles Geschäftsmodell hatten, geraten nun endgültig in Schieflage.
Dazu zählen Betriebe mit geringer Digitalisierung, niedriger Eigenkapitalquote oder einem stark von externen Faktoren abhängigen Geschäftsmodell. Viele Insolvenzen sind daher nicht nur Ergebnis eines einmaligen Schocks, sondern Ausdruck mangelnder Zukunftsfähigkeit.
Zugleich zeigt der Anstieg aber auch, dass sich der Markt neu sortiert. Insolvenzen bedeuten nicht zwingend ein Versagen der Wirtschaft, sondern können auch Bereinigungsprozesse einleiten, durch die gesündere Strukturen entstehen. Doch dieser Übergang ist schmerzhaft – für Mitarbeiter, Gläubiger und Regionen gleichermaßen.
Fazit: Eine stille Krise mit langfristigen Folgen
Der aktuelle Creditreform-Report macht deutlich: Europa steckt mitten in einer Phase schleichender wirtschaftlicher Erschöpfung. Die steigenden Insolvenzen sind mehr als eine Zahl – sie sind ein Indikator für den schwindenden Puffer vieler Unternehmen, für die Risiken einer kreditfinanzierten Wirtschaft in Zeiten steigender Zinsen und für die Grenzen politischer Hilfsmaßnahmen.
Was bleibt, ist die Erkenntnis, dass wirtschaftliche Resilienz nicht nur in guten Zeiten aufgebaut werden muss, sondern sich gerade in schwierigen Zeiten bewährt. Für Politik, Wirtschaft und Gesellschaft bedeutet das: Die kommenden Monate sind nicht nur eine Herausforderung – sondern auch eine Bewährungsprobe für Europas ökonomisches Selbstverständnis.
Erst der Mensch, dann das Geschäft