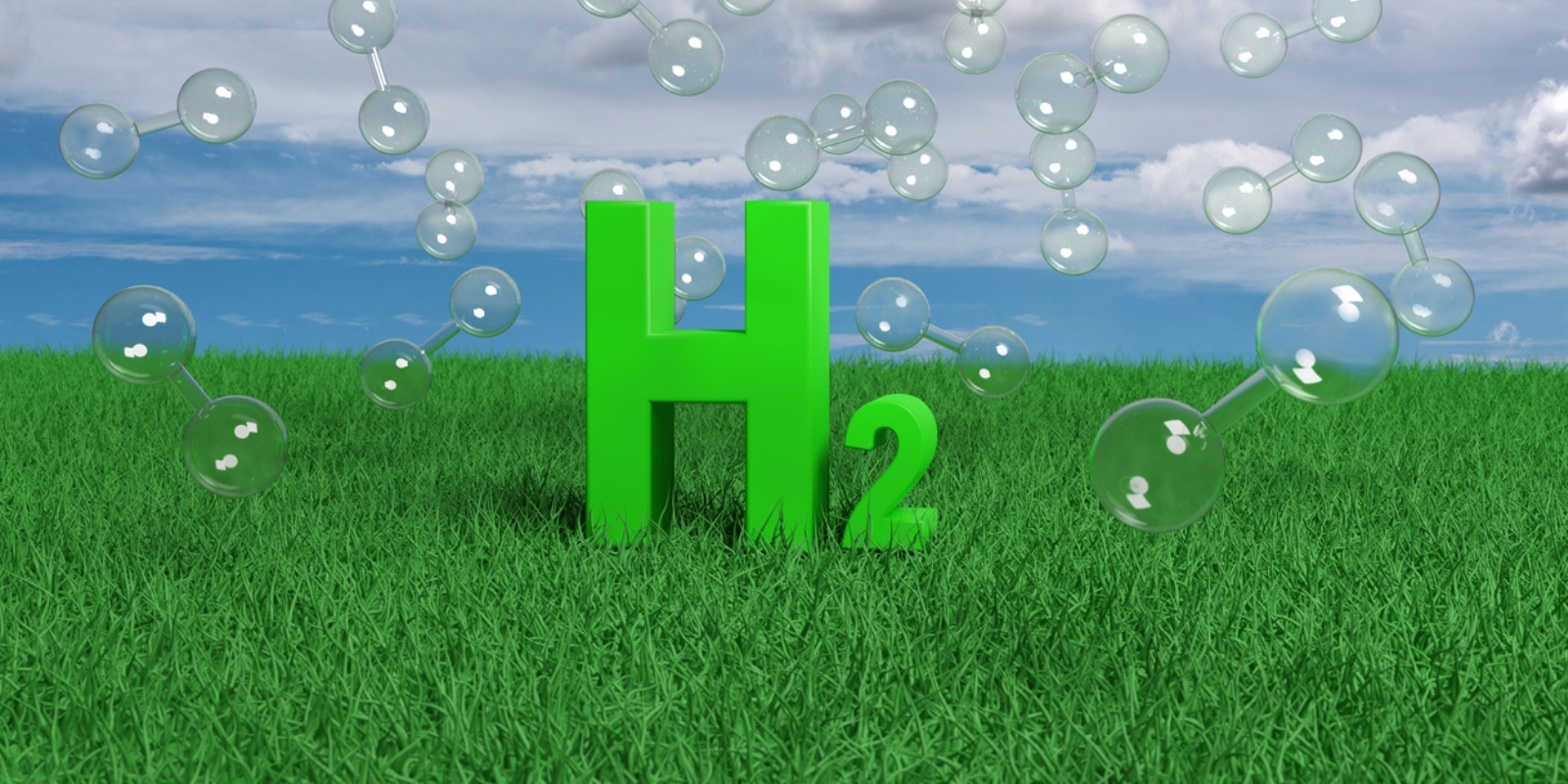Finanzlexikon Korrelation ist nicht Diversifikation
Warum Anleger nicht nur auf Streuung setzen sollten, sondern auf das richtige Verständnis von Zusammenhängen.
Diversifikation ist eine der grundlegendsten Empfehlungen der modernen Geldanlage. Wer sein Kapital auf verschiedene Anlageklassen verteilt, so heißt es, senkt sein Risiko und sorgt für stabilere Erträge. In ihrer Theorie ist diese Annahme richtig – doch in der Praxis führt sie oft in die Irre. Denn nicht jede Streuung ist auch wirksam, nicht jede Kombination von Vermögenswerten schützt vor Verlusten.
Entscheidend ist nicht, wie viele Positionen ein Portfolio enthält, sondern wie diese zueinander stehen. Korrelationen – also statistische Zusammenhänge zwischen Kursbewegungen – spielen dabei eine zentrale Rolle. Und gerade sie verhalten sich nicht konstant, sondern verändern sich mit dem Marktumfeld.
Was Korrelation wirklich bedeutet
Korrelation ist nicht gleich Diversifikation. Eine Vielzahl von Anlageklassen schützt nur dann vor Verlusten, wenn ihre Reaktionen wirklich unabhängig voneinander sind. In einer Welt, in der Märkte zunehmend miteinander vernetzt sind, erfordert das mehr denn je ein tiefes Verständnis für ökonomische Zusammenhänge."
Doch hier beginnt die Herausforderung: Diese Zusammenhänge sind nicht in Stein gemeißelt. Was in ruhigen Marktphasen diversifizierend wirkt, kann in Stressphasen plötzlich gleich ticken. Aktien und Anleihen zum Beispiel galten lange als Gegenpole – doch in Zeiten von Inflation oder geldpolitischer Unsicherheit kann auch diese Beziehung kippen.
Schein-Diversifikation durch ähnliche Reaktionen
Viele Anleger verlassen sich auf eine große Anzahl unterschiedlicher Fonds, Regionen oder Branchen. Doch eine breite Streuung ist nicht automatisch wirksam, wenn die enthaltenen Werte auf die gleichen Impulse reagieren.
Ein Portfolio aus US-Tech-Aktien, globalen Wachstumsfonds und Innovations-ETFs mag auf dem Papier als diversifiziert erscheinen. In der Praxis zeigt sich oft: Die Kursmuster sind hoch korreliert, weil die zugrunde liegenden Geschäftsmodelle und Bewertungslogiken ähnlich sind.
Selbst Anlagen, die auf den ersten Blick unabhängig erscheinen – etwa Immobilienaktien und Infrastruktur-ETFs – können gleichzeitig unter steigenden Zinsen oder Konjunktursorgen leiden. Diversifikation verfehlt dann ihre eigentliche Funktion: nicht die Rendite zu maximieren, sondern das Risiko zu kontrollieren.
Warum Korrelation dynamisch ist – und was das für Anleger bedeutet
Korrelationen zwischen Anlageklassen ändern sich je nach Marktphase. In Boomzeiten funktionieren viele Strategien scheinbar problemlos. In Krisenphasen jedoch steigen die Gleichläufigkeiten – alles fällt gleichzeitig, weil Investoren panikartig Kapital abziehen, Liquidität suchen oder auf Sicherheitsmechanismen wie Margin Calls reagieren müssen.
Gerade in solchen Phasen zeigt sich, ob ein Portfolio wirklich robust aufgestellt ist. Die eigentliche Herausforderung liegt also darin, nicht nur nach historischer Korrelation zu handeln, sondern Szenarien zu antizipieren, in denen sich Muster verändern.
Ein Beispiel: Gold wird häufig als Krisenabsicherung genannt. Doch es reagiert nicht auf jede Krise gleich – seine Rolle hängt von Inflation, Zinsen, geopolitischen Faktoren und Dollarstärke ab. Historische Korrelationen sind also nur eine Momentaufnahme, keine verlässliche Zukunftsprognose.
Was wirklich zählt: Zusammenhang verstehen statt Muster nachbauen
box
Anleger, die Diversifikation ernst nehmen, sollten sich weniger auf die bloße Zahl der Positionen konzentrieren – und mehr auf deren ökonomische Eigenschaften. Es geht um Fragen wie:
- Welche Risiken wirken in den einzelnen Anlageklassen?
- Was beeinflusst deren Bewertung – Zinsen, Wachstum, Liquidität, Politik?
- Welche externen Schocks könnten mehrere Positionen gleichzeitig treffen?
Nur wer diese Fragen durchdringt, kann ein Portfolio bauen, das sich auch in schwierigen Phasen bewährt.
Dazu gehört auch, immer wieder zu überprüfen, ob Korrelationen noch gelten – und nicht der Trägheit historischer Daten zu vertrauen.
Fazit: Diversifikation braucht Tiefe – nicht Breite
Korrelation ist nicht gleich Diversifikation. Eine Vielzahl von Anlageklassen schützt nur dann vor Verlusten, wenn ihre Reaktionen wirklich unabhängig voneinander sind. In einer Welt, in der Märkte zunehmend miteinander vernetzt sind, erfordert das mehr denn je ein tiefes Verständnis für ökonomische Zusammenhänge.
Wer dieses Verständnis mit disziplinierter Umsetzung kombiniert, schafft sich ein Portfolio, das nicht nur in Aufschwüngen glänzt, sondern auch in Stürmen trägt. Und genau darum geht es in der Geldanlage: nicht um Perfektion – sondern um Widerstandsfähigkeit.

Ich repariere Versicherungsverträge und Finanzdienstleistungen!