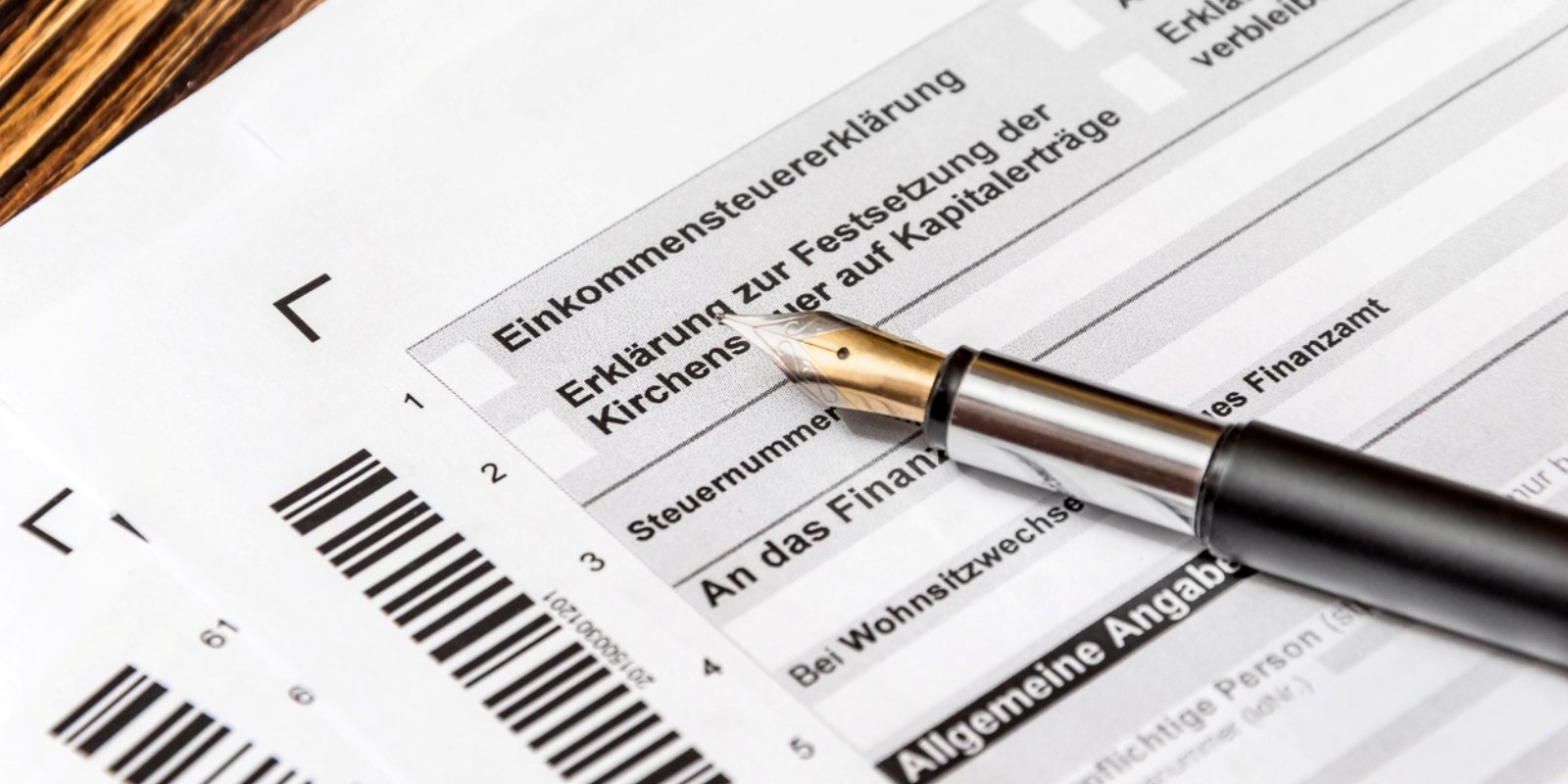Serie Finanzwissen: Schweizer lehnen Erbschaftssteuer-Idee ab Angst vor Abwanderung
In den aktuellen Umfragen dominiert die Sorge, eine 50-Prozent-Abgabe auf Erbschaften über 50 Mio. könnte falsche Signale senden und Abwanderung fördern.
Eine Volksinitiative der Jungsozialisten will sehr grosse Nachlässe und Schenkungen mit 50 Prozent besteuern – erst ab einem Schwellenwert von 50 Millionen Franken, die Einnahmen sollen dem Klimaschutz dienen. Laut Umfragen lehnen jedoch rund zwei Drittel der Stimmberechtigten die Vorlage ab. Im Zentrum der Skepsis stehen die Signale für den Standort Schweiz: Viele befürchten Abwanderung vermögender Familien, einen Imageschaden und Folgewirkungen für Investitionen und Arbeitsplätze.
Die Vorlage in Kürze – und weshalb sie polarisiert
Die Initiative kombiniert eine schmale Bemessungsgrundlage (nur sehr grosse Vermögen) mit einem hohen Satz. Befürworter betonen, die Abgabe treffe ausschliesslich die Leistungsfähigsten und liefere eine zweckgebundene Finanzierung für Klimamassnahmen. Gegner sehen eine Symbolsteuer, die zwar wenige direkt betrifft, aber prinzipielle Fragen auslöst: Darf eine einzelne Gruppe stark belastet werden, ohne dass das Steuersystem als Ganzes neu gedacht wird? Und wie passt das zur Tradition moderater Sätze und eines lebhaften Steuerwettbewerbs?
Warum das Abwanderungsargument so wirkmächtig ist
box
Ob Vermögende tatsächlich in grosser Zahl umziehen, ist schwer zu belegen.
Politisch entscheidend ist die Signalwirkung.
Drei Punkte prägen die Wahrnehmung:
- Planbarkeit als Standortwert: Die Schweiz lebt vom Ruf verlässlicher Rahmenbedingungen. Eine sehr hohe Steuer auf einen eng gefassten Personenkreis gilt vielen als Dammbruchsignal.
- Wettbewerbsebene: Die Steuerpolitik ist traditionell stark kantonal geprägt. Eine harte nationale Zusatzsteuer wird als Eingriff in dieses Gleichgewicht verstanden.
- Folgekaskaden: Vermögende bringen nicht nur Steuern, sondern auch Unternehmenssitze, Stiftungen, Aufträge für Dienstleister und Ankerinvestments. Schon kleine Verschiebungen können in Ökosystemen spürbar sein.
Historischer Kontext: Misstrauen gegenüber nationalen Erbschaftssteuern
Die Schweiz hat Erfahrungen mit Vorstössen zu nationalen Erbschaftssteuern – und eine Geschichte breiter Ablehnungen. Das prägt bis heute die Erwartungen: Nationale Lösungen gelten als schwer mehrheitsfähig, während kantonale Regeln, Freibeträge und Ausnahmen für direkte Nachkommen als flexibler empfunden werden. Vor diesem Hintergrund wirkt eine 50-Prozent-Abgabe wie ein Bruch mit eingeübter Systemlogik.
Argumente der Befürworter – und warum sie bisher wenig durchdringen
Die Initianten verweisen auf Treffsicherheit (nur sehr grosse Vermögen), Gerechtigkeit und die Dringlichkeit der Klimafinanzierung. Zudem verweisen sie auf die Stabilitätsfaktoren der Schweiz, die nicht einfach „umziehen“: Rechtsstaat, Bildung, Infrastruktur. In den Umfragen überwiegt dennoch die Sorge, dass ein falsches Signal an international mobile Familien und Unternehmer gesendet wird.
Politische Ökonomie der Ablehnung
Die Mehrheit der Befragten sieht in der nationalen Erbschaftssteuer für Superreiche vor allem ein Risikosignal – mit möglichen Kettenreaktionen bei Investitionen, Philanthropie und Beschäftigung."
Drei Deutungslinien erklären das deutliche Nein-Lager:
- System vs. Symbol: Breite Bemessungsgrundlagen mit moderaten Sätzen sind in der Schweiz populärer als spitze Steuern mit hohen Sätzen.
- Pfadabhängigkeit: Frühere klare Neins wirken nach und verstärken das Grundmisstrauen gegen nationale Erbschaftssteuern.
- Klimapolitik ohne Zielgruppensteuer: Viele befürworten Klimaschutz, möchten die Finanzierung jedoch breiter verteilen (ordentlicher Haushalt, Lenkungsabgaben), nicht auf eine kleine Gruppe abstellen.
Was ein Nein bedeuten würde – und was nicht
Ein Nein wäre keine Absage an Klimapolitik, sondern an diesen Finanzierungsweg. Politisch wahrscheinlich wären Diskussionen über alternative Quellen und kantonale Weiterentwicklungen der Nachlassbesteuerung. Die Standort-DNA – Wettbewerb zwischen Kantonen, moderate Sätze, hohe Planbarkeit – bliebe im Kern bestehen.
Implikationen für Vermögensplanung und Unternehmen
Unabhängig vom Abstimmungsausgang gewinnen Struktur und Frühzeitigkeit an Bedeutung:
- Nachfolge regeln: Testamente, Familienverfassungen, Stiftungen/Trust-Lösungen und klare Governance mindern Streit und sichern Handlungsfähigkeit.
- Standortfragen nüchtern betrachten: Steuerliche Überlegungen sind wichtig, aber nicht allein ausschlaggebend. Lebensqualität, Bildung, Gesundheitssystem, Netzwerke und Sprache spielen ebenfalls eine Rolle.
- Kantonale Unterschiede kennen: Freibeträge, Befreiungen für direkte Nachkommen und die Behandlung von Betriebsvermögen variieren – das eröffnet Gestaltungsspielräume.
Kommunikationslage und Kampagnendynamik
Die Kombination aus deutlichem Umfragebild, Skepsis der Bundesbehörden und Warnungen der Wirtschaft erzeugt einen Schutzreflex zugunsten des Status quo. Unentschlossene orientieren sich häufig an Institutionen und Verbänden, wenn die Folgen als asymmetrisch wahrgenommen werden: Potenzieller Schaden bei Fehlkonstruktion gross, erwartete Mehreinnahmen relativ klein und unsicher.
Was aus der Debatte langfristig bleibt
Selbst bei einer Ablehnung dürfte das Thema Vermögensübergang präsent bleiben: Alternde Unternehmergenerationen, Nachfolge in Familienbetrieben, internationale Mobilität und die Suche nach gesellschaftlicher Akzeptanz hoher Vermögen. Daraus entstehen politische Felder jenseits der grossen Steuerkeule: Stiftungsrecht, Erleichterungen bei Unternehmensnachfolge, Transparenzstandards und lenkende Abgaben ohne Zielgruppenspitze.
Fazit
Die Auseinandersetzung ist weniger ein Streit um Zahlen als um Prinzipien: Zielgruppenspezifische Hochsteuer gegen systemische Planbarkeit und Standortwettbewerb. Die Mehrheit der Befragten sieht in der nationalen Erbschaftssteuer für Superreiche vor allem ein Risikosignal – mit möglichen Kettenreaktionen bei Investitionen, Philanthropie und Beschäftigung. Selbst wenn Klimafinanzierung dringend ist, überzeugt die vorgeschlagene Konstruktion viele nicht. Wer privat oder unternehmerisch plant, ist gut beraten, kantonal zu denken, Nachfolge früh zu ordnen und Emotionen von Standortlogik zu trennen. So bleibt Handlungsfreiheit – unabhängig vom Ausgang der Abstimmung.

Ich glaube, dass Menschen, die sich ihrer Ziele und Werte bewusst werden, sorgenfreier leben.