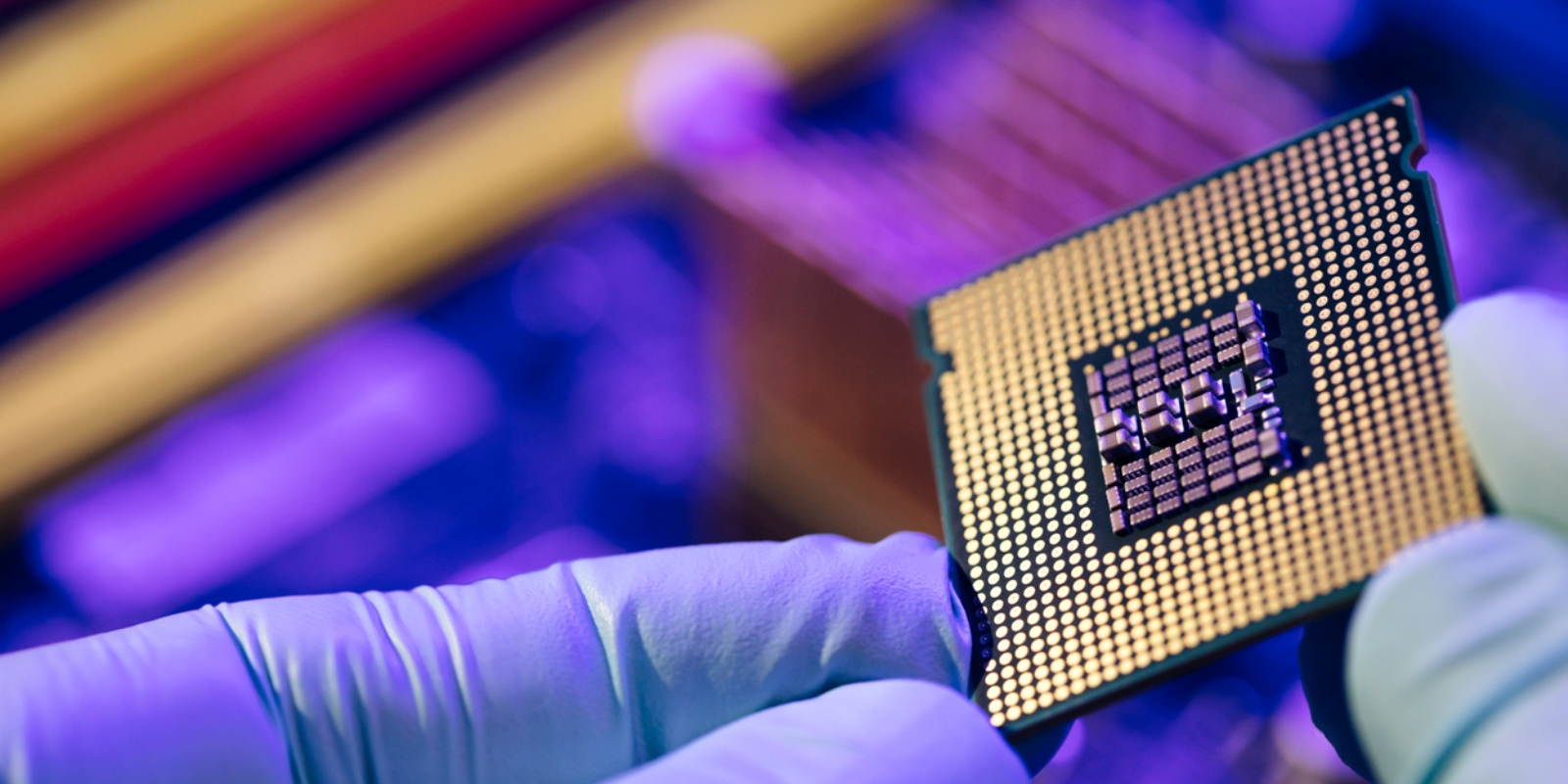Design Thinking – nicht automatisch neutral Bias-Training und Design Thinking
Design Thinking gilt als eine der beliebtesten Methoden, um kundenorientierte Innovation zu fördern. Es kombiniert nutzerzentriertes Denken, interdisziplinäre Zusammenarbeit und iterative Prototypenentwicklung.
Was in Workshops oft als strukturierter Kreativprozess daherkommt, ist in der Praxis ein Werkzeug für komplexe Herausforderungen – gerade dort, wo Standardlösungen versagen. Doch so stark Design Thinking auf den Nutzer ausgerichtet ist, so wenig schützt es von selbst vor einer zentralen Gefahr: kognitiven und strukturellen Verzerrungen, also Biases, die den Blick verengen, Gruppen ausblenden oder stereotype Annahmen festschreiben.
Hier kommt Bias-Training ins Spiel. Es ergänzt Design Thinking nicht nur sinnvoll, sondern ist vielfach dessen notwendige Voraussetzung – insbesondere dann, wenn es um gesellschaftlich relevante Technologien, inklusive Produkte oder diversitätssensible Dienstleistungen geht.
Design Thinking – offen, kreativ, aber nicht automatisch neutral
Die Stärke von Design Thinking liegt in seiner methodischen Offenheit. Statt von technischen Lösungen auszugehen, stellt es den Menschen und seine Bedürfnisse in den Mittelpunkt. Empathiephasen, Nutzerinterviews und iterative Tests sollen sicherstellen, dass die Lösungen „vom Nutzer her gedacht“ sind.
Doch wer als Nutzer gilt, wie Bedürfnisse erhoben werden und welche Ideen es durch den Auswahlprozess schaffen, hängt stark von impliziten Annahmen, Teamstrukturen und kulturellen Prägungen ab. In homogenen Gruppen besteht die Gefahr, dass blinde Flecken bestehen bleiben – etwa, wenn bestimmte Altersgruppen, Herkunftsmilieus oder Einschränkungen gar nicht mitgedacht werden. Design Thinking ist kein Schutz vor Bias – es kann ihn sogar festigen, wenn Reflexion fehlt.
Bias-Training als Ergänzung: Bewusstsein schaffen vor dem Prototypen
box
Bias-Training setzt genau an diesem Punkt an.
Es hilft Teams dabei, versteckte Denkmuster und Stereotype zu erkennen, die unbewusst in die Bedarfsdefinition oder Lösungsentwicklung einfließen.
Das kann bedeuten, bestimmte Fragetechniken in Interviews zu überdenken, die Zusammensetzung der Persona-Modelle zu diversifizieren oder bewusst „untypische Nutzer“ einzuladen.
In der Praxis ist es sinnvoll, Bias-Sensibilisierung frühzeitig in den Design-Thinking-Prozess einzubauen – insbesondere in den Phasen:
- Empathize (Verstehen und Beobachten): Wer wird überhaupt befragt? Wer bleibt außen vor? Welche Vorannahmen prägen unsere Beobachtung?
- Define (Problemdefinition): Wird ein Bedürfnis universell formuliert oder aus einer engen Nutzererfahrung abgeleitet?
- Ideate (Ideenfindung): Entsteht Vielfalt in den Lösungsvorschlägen – oder bestätigt sich das Weltbild des Teams?
Ein gutes Bias-Training gibt hier nicht die Antworten vor, sondern stellt die richtigen Fragen – methodisch fundiert und in der Sprache der Designpraxis.
Wirkung auf Teamdynamik und Lösungsqualität
Design Thinking ist ein mächtiges Instrument für kreative Problemlösung. Doch um wirklich inklusive und faire Lösungen zu entwickeln, reicht Empathie allein nicht aus. Es braucht zusätzlich eine strukturierte Auseinandersetzung mit eigenen Vorannahmen – also Bias-Training, das nicht nur auf Wissen, sondern auf Haltung zielt."
Die Verbindung von Bias-Training und Design Thinking verändert nicht nur Ergebnisse, sondern auch Teamprozesse und Denkhaltungen. Teams, die sich mit eigenen Denkmustern auseinandersetzen, entwickeln eine tiefere Form von Empathie – nicht nur gegenüber Nutzern, sondern auch untereinander. Das fördert Offenheit, Perspektivenvielfalt und Selbstkorrektur.
Zugleich steigt die Qualität der Lösungen. Produkte und Dienstleistungen, die durch bias-sensible Prozesse entstanden sind, sind oft robuster, integrativer und tragfähiger – nicht nur sozial, sondern auch wirtschaftlich. Denn sie adressieren breitere Nutzergruppen, vermeiden spätere Reputationsrisiken und erfüllen wachsende Erwartungen an ethisch reflektierte Innovation.
Integration in die Praxis: Von der Haltung zur Methode
Damit die Verbindung von Bias-Training und Design Thinking nicht bei punktuellen Workshops stehen bleibt, braucht es institutionelle Verankerung. Das kann zum Beispiel bedeuten:
- Bias-Checks als festen Bestandteil jeder Sprintplanung oder Projektinitiierung einzuführen.
- Diversitätsindikatoren in die Nutzerforschung und Persona-Entwicklung zu integrieren.
- Rollen im Team zu etablieren, die explizit für kritische Reflexion zuständig sind („Bias Champion“).
- Methoden wie „Assumption Busting“, „Ethical Prototyping“ oder „Inclusion Lenses“ systematisch einzubinden.
Auf diese Weise wird Bias-Sensibilität nicht als Zusatz, sondern als Qualitätsmerkmal des gesamten Innovationsprozesses etabliert.
Fazit: Menschzentrierung braucht Selbstreflexion
Design Thinking ist ein mächtiges Instrument für kreative Problemlösung. Doch um wirklich inklusive und faire Lösungen zu entwickeln, reicht Empathie allein nicht aus. Es braucht zusätzlich eine strukturierte Auseinandersetzung mit eigenen Vorannahmen – also Bias-Training, das nicht nur auf Wissen, sondern auf Haltung zielt.
Die Verbindung beider Elemente – kreatives Denken und kritisches Hinterfragen – macht den Unterschied zwischen gut gemeint und gut gemacht. Sie ermöglicht Innovationen, die nicht nur neu, sondern auch gerecht und nachhaltig sind.

Ich repariere Versicherungsverträge und Finanzdienstleistungen!