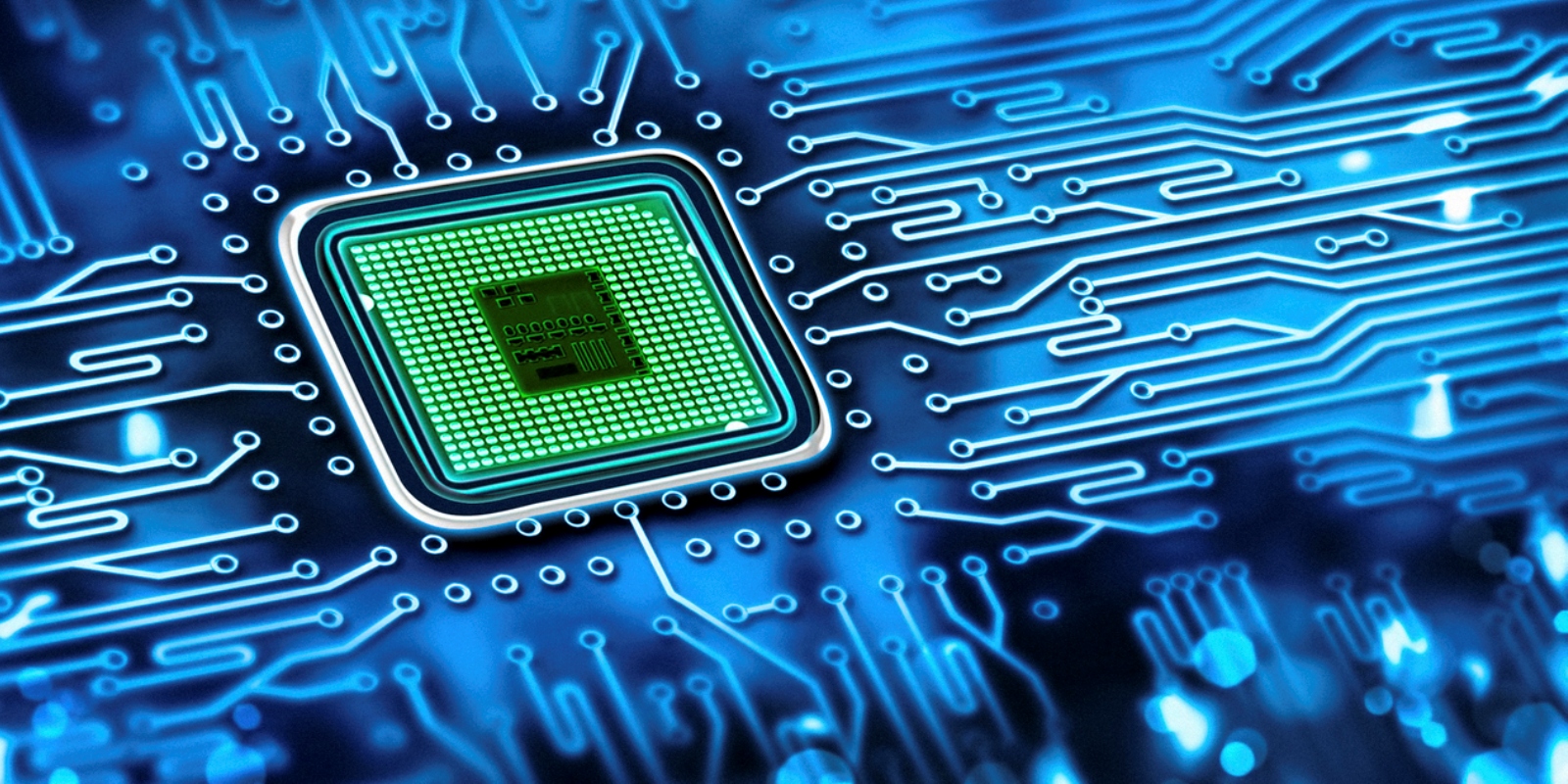Goldexperte fühlt sich an die 1970er erinnert „Das ist Stagflation“
Warum das Edelmetall in einer Welt aus schwachem Wachstum und hartnäckiger Inflation wieder glänzt.
Es ist eine Situation, die viele längst für undenkbar hielten: kaum Wirtschaftswachstum, aber steigende Preise – Stagflation. Was in den 1970er-Jahren ganze Volkswirtschaften lähmte, kehrt in abgeschwächter Form zurück. Hohe Energiepreise, teure Kredite und schleppende Produktivität treffen auf eine Geldpolitik, die zwischen Inflationsbekämpfung und Wachstumsstützung gefangen ist.
In diesem Spannungsfeld sieht Ned Naylor-Leyland, Manager des Jupiter Gold & Silver Fund, Parallelen zur Zeit der Ölkrisen. Wie damals könnte Gold der große Gewinner werden – nicht aus Euphorie, sondern aus Mangel an Alternativen.
Die Rückkehr der Stagflation
box
Stagflation ist das gefährlichste Szenario für Zentralbanken. Sie beschreibt eine Phase, in der das Wirtschaftswachstum stagniert, während die Preise steigen.
Normalerweise gilt: Inflation geht mit Expansion einher, Deflation mit Rezession. Doch Stagflation widerspricht dieser Logik.
Heute zeigt sich ein ähnliches Muster wie in den 1970ern:
- Die Inflation bleibt trotz Zinserhöhungen über den Zielwerten.
- Das Wirtschaftswachstum in Europa und den USA liegt nahe der Nulllinie.
- Die Energiepreise bleiben strukturell hoch, getrieben durch geopolitische Spannungen und Transformationseffekte.
Zentralbanken stecken im Dilemma: Senken sie die Zinsen, riskieren sie neue Preisschübe.
Halten sie sie hoch, würgen sie Investitionen ab.
Das Ergebnis: ein verunsicherter Kapitalmarkt, der Sicherheit sucht – und sie im Gold findet.
Gold als Spiegel wirtschaftlicher Unsicherheit
Für Naylor-Leyland ist der jüngste Anstieg des Goldpreises keine Blase, sondern eine logische Marktreaktion. Gold wirft keine Zinsen ab, doch in einem Umfeld, in dem reale Renditen sinken und Vertrauen in Papiergeld schwindet, gewinnt es an Attraktivität.
„Das Edelmetall reagiert nicht auf Inflation allein“, erklärt der Fondsmanager, „sondern auf den Verlust geldpolitischer Glaubwürdigkeit.“ Wenn Investoren glauben, dass Notenbanken zwischen Inflationsbekämpfung und Wachstumssicherung zerrieben werden, flüchten sie in Sachwerte.
Die aktuelle Lage erinnert frappierend an 1973 bis 1979: Damals stieg der Goldpreis von 35 auf über 800 US-Dollar – ein Plus von mehr als 2.000 Prozent – während Inflation, Ölkrise und geopolitische Unsicherheit das Vertrauen in Währungen untergruben.
Die Notenbanken als stille Käufer
Ein entscheidender Unterschied zu früher: Heute treiben nicht nur Privatanleger, sondern auch Zentralbanken den Goldpreis. Laut Daten des World Gold Council kauften Notenbanken 2023 weltweit über 1.000 Tonnen Gold – der höchste Wert seit Beginn der Aufzeichnungen.
Besonders aktiv sind die Zentralbanken der Schwellenländer, allen voran China, Indien und die Türkei.
Sie sehen Gold als strategische Reserve – unabhängig von geopolitischen Zwängen und westlichen Währungen.
Dieser Trend verleiht dem Markt eine neue strukturelle Unterstützung: Gold ist nicht nur Krisenversicherung, sondern politische Absicherung gegen den Dollar.
Die Parallelen und Unterschiede zu den 1970ern
Die Erinnerung an die 1970er ist mehr als ein historischer Vergleich – sie ist eine Warnung. Eine Welt ohne Wachstum, aber mit Inflation, stellt die Geldpolitik vor Aufgaben, die sie allein nicht lösen kann. In dieser Unsicherheit wird Gold wieder zu dem, was es seit Jahrtausenden ist: das Maß des Misstrauens. Es glänzt nicht, weil die Zukunft rosig ist, sondern weil sie ungewiss bleibt."
Der Vergleich zur Ära der Ölkrisen liegt nahe, aber die Welt hat sich verändert. Damals war die Inflation durch Löhne und Energiepreise getrieben, heute durch Lieferketten, geopolitische Unsicherheit und strukturellen Wandel. Auch die Geldpolitik agiert heute proaktiver – doch ihre Wirkung ist begrenzt.
Trotzdem erkennt Naylor-Leyland eine gefährliche Ähnlichkeit: Wie damals droht das Vertrauen in geldpolitische Steuerung zu erodieren. „Die Märkte spüren, dass die Zentralbanken keine klare Exitstrategie haben“, sagt er. „Das ist der Nährboden für Gold.“
Warum Gold jetzt profitiert
Mehrere Faktoren stützen den aktuellen Aufwärtstrend:
- Reale Zinsen sinken, da Inflation hartnäckig bleibt und Wachstum nachlässt.
- Währungsdiversifizierung: Notenbanken und Fonds reduzieren Dollar-Exposure.
- Geopolitische Unsicherheit: Spannungen im Nahen Osten, China-USA-Konflikte und politische Polarisierung in den USA erhöhen den Risikoappetit für Sachwerte.
- Technische Unterstützung: Gold durchbricht regelmäßig charttechnische Widerstände und zieht dadurch Momentum-Investoren an.
Für viele Anleger gilt Gold derzeit als das „bessere Cash“ – liquide, wertbeständig und frei von Gegenparteirisiko.
Die Grenzen des Goldbooms
Doch auch Gold ist kein Selbstläufer. Bei einer nachhaltigen Zinswende oder wirtschaftlichen Erholung könnte der Aufwärtstrend ins Stocken geraten. Auch ein starker Dollar oder fallende Energiepreise würden Gegenwind erzeugen.
Entscheidend bleibt, ob die Inflation dauerhaft oberhalb der Zielmarke verharrt und die Realzinsen niedrig bleiben. Dann hätte Gold strukturellen Rückenwind – andernfalls droht eine Seitwärtsphase auf hohem Niveau.
Naylor-Leyland bleibt dennoch überzeugt: „Wir befinden uns nicht in einem kurzfristigen Hype, sondern in einem neuen monetären Zyklus. Gold ist die Versicherung gegen politische und wirtschaftliche Ratlosigkeit.“
Fazit
Die Erinnerung an die 1970er ist mehr als ein historischer Vergleich – sie ist eine Warnung. Eine Welt ohne Wachstum, aber mit Inflation, stellt die Geldpolitik vor Aufgaben, die sie allein nicht lösen kann. In dieser Unsicherheit wird Gold wieder zu dem, was es seit Jahrtausenden ist: das Maß des Misstrauens. Es glänzt nicht, weil die Zukunft rosig ist, sondern weil sie ungewiss bleibt.

Maßgeschneiderte Anlagelösungen mit zuverlässigem Risikomanagement. Dabei stets transparent, ehrlich & fair.