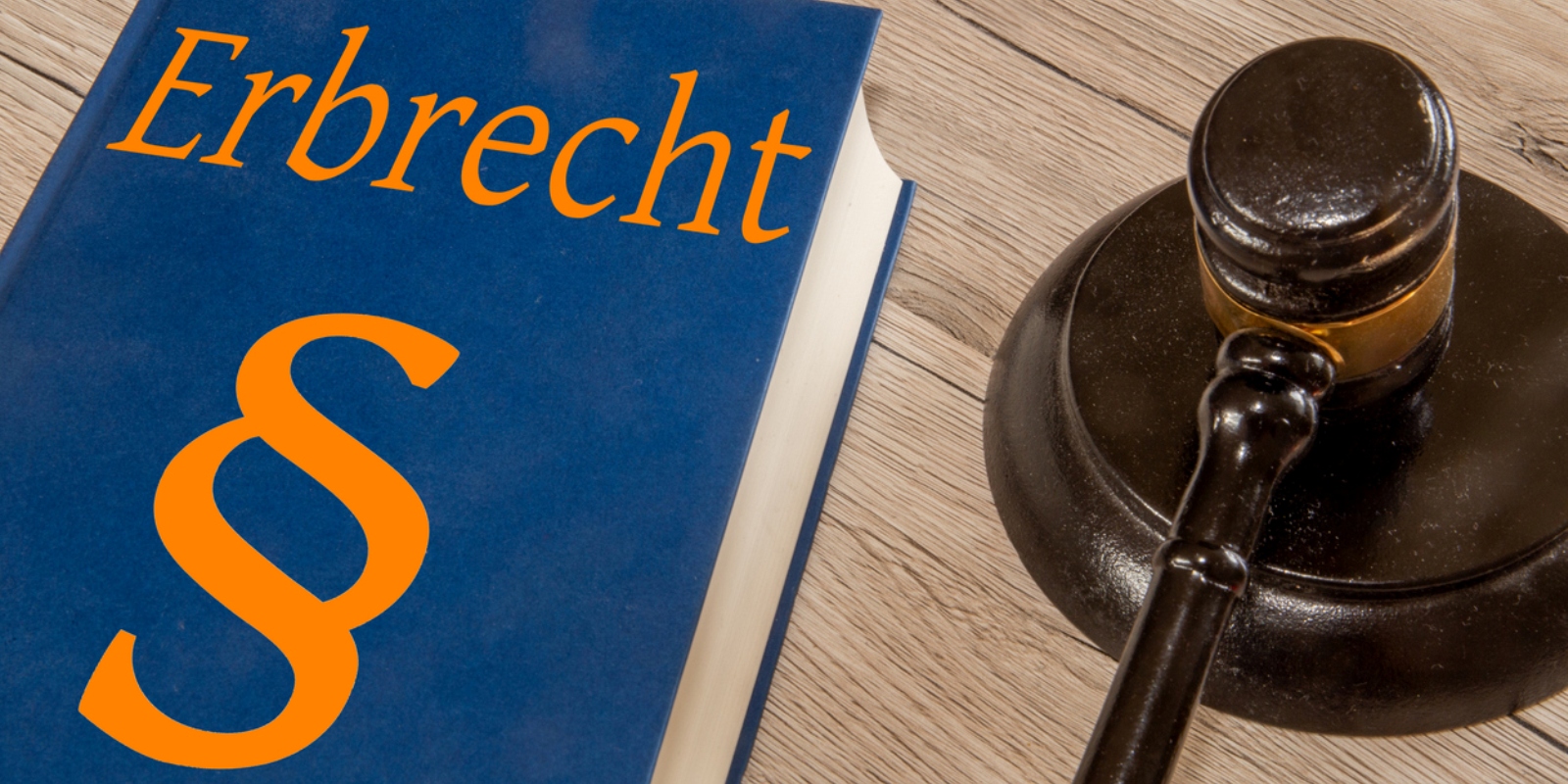Finanzlexikon Nachhaltigkeit im Doppel
Wie Fonds und ETFs grüne Kriterien umsetzen.
Nachhaltigkeit hat in den vergangenen Jahren Einzug in die Welt der Geldanlage gehalten – nicht nur als moralisches Argument, sondern als strategischer Faktor. Fonds und ETFs stehen dabei vor derselben Aufgabe: Kapitalströme so zu lenken, dass sie ökologische und soziale Ziele fördern, ohne finanzielle Stabilität zu gefährden. Doch die Wege dorthin unterscheiden sich.
Fondsmanager interpretieren Nachhaltigkeit aktiv. Sie wählen Unternehmen aus, die bestimmte Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien (ESG) erfüllen, und schließen andere aus. ETFs dagegen übersetzen Nachhaltigkeit in Regeln: Sie bilden Indizes nach, die diese Kriterien bereits systematisch berücksichtigen. So entsteht eine zweigeteilte Dynamik zwischen Gestaltung und Abbildung, zwischen aktivem Urteil und algorithmischer Umsetzung.
ESG als Strukturprinzip
box
Die Einführung von ESG-Kriterien veränderte die Fondsbranche grundlegend. Nachhaltigkeit ist nicht länger ein Zusatz, sondern Teil des Bewertungsrahmens geworden. Ratingagenturen, Regulierungsbehörden und Investoren verlangen Nachweise, wie Kapitalströme mit Klimazielen und gesellschaftlicher Verantwortung vereinbar sind.
Typische ESG-Strategien im Fonds- und ETF-Bereich:
- Ausschlussansatz: Verzicht auf Branchen oder Unternehmen mit hohen Umwelt- oder Sozialrisiken.
- Best-in-Class-Prinzip: Auswahl der nachhaltigsten Unternehmen innerhalb einer Branche.
- Themenfonds: gezielte Anlage in Zukunftssektoren wie erneuerbare Energien oder Kreislaufwirtschaft.
- Engagement und Stimmrechtsausübung: aktive Einflussnahme auf Unternehmenspolitik durch Fondsmanager.
Diese Strategien können sich überlappen, unterscheiden sich jedoch in der Intensität der Umsetzung.
Unterschiede in der Umsetzung
Aktive Fonds nutzen Nachhaltigkeit als Teil ihrer Managemententscheidung. Sie können flexibel auf neue Daten reagieren, Unternehmen direkt ansprechen und Stimmrechte gezielt ausüben. Ihre Wirkung entsteht aus dem Zusammenspiel von Analyse, Dialog und Kapitalallokation.
ETFs hingegen sind an ihre Indizes gebunden. Nachhaltigkeit wird hier algorithmisch abgebildet: Nur Unternehmen, die in einem ESG-Index gelistet sind, werden berücksichtigt. Dadurch sind Anpassungen weniger dynamisch, aber klar nachvollziehbar. Die Stärke liegt in der Transparenz, die Schwäche in der fehlenden Flexibilität.
Kurz gesagt:
- Fonds interpretieren Nachhaltigkeit,
- ETFs standardisieren sie.
Beide Systeme tragen auf unterschiedliche Weise zur Transformation von Märkten bei – der eine über gezielte Einflussnahme, der andere über die Breitenwirkung.
Regulatorische Impulse
Nachhaltigkeit hat Fonds und ETFs näher zueinander gebracht, auch wenn ihre Mechanismen unterschiedlich bleiben. Beide tragen dazu bei, Kapitalströme in Richtung ökologischer und sozialer Ziele zu lenken."
Die Europäische Union hat mit der Offenlegungsverordnung (SFDR) und der Taxonomie-Verordnung verbindliche Rahmen geschaffen. Sie verlangen von Fonds und ETFs, Nachhaltigkeitsziele zu definieren, offenzulegen und zu bewerten. Das Ziel ist, Greenwashing zu vermeiden und Anlegern eine nachvollziehbare Grundlage für Entscheidungen zu bieten.
Für die Anbieter bedeutet das:
- Einheitliche Klassifizierung nachhaltiger Produkte,
- Offenlegung von Nachhaltigkeitsrisiken und Wirkungskriterien,
- Vergleichbarkeit über verschiedene Märkte hinweg.
Die Regulierung schiebt damit beide Systeme in dieselbe Richtung – hin zu messbarer, überprüfbarer Nachhaltigkeit.
Markt und Wahrnehmung
Nachhaltige Fonds und ETFs sind längst kein Nischenprodukt mehr. Ihr Anteil am Gesamtmarkt wächst stetig, getrieben von politischem Druck, institutioneller Nachfrage und gesellschaftlichen Erwartungen. Dennoch bleibt die Definition von Nachhaltigkeit uneinheitlich. Während aktive Fonds mehr Deutungsspielraum haben, wirken ETFs oft glaubwürdiger, weil ihre Regeln nachvollziehbar sind.
Das Vertrauen der Anleger verteilt sich daher unterschiedlich:
- Wer Wirkung sucht, neigt zum aktiv gemanagten Fonds.
- Wer Klarheit und Kostenkontrolle bevorzugt, greift zum ESG-ETF.
Diese Rollenverteilung könnte sich mit zunehmender Datenqualität und digitaler Analyse weiter verschieben.
Fazit
Nachhaltigkeit hat Fonds und ETFs näher zueinander gebracht, auch wenn ihre Mechanismen unterschiedlich bleiben. Beide tragen dazu bei, Kapitalströme in Richtung ökologischer und sozialer Ziele zu lenken. Entscheidend ist weniger, ob aktiv oder passiv, sondern wie konsequent die zugrunde liegenden Regeln und Bewertungen angewandt werden. Die grüne Geldanlage zeigt, dass Verantwortung heute messbar, aber nicht automatisierbar ist – und dass nachhaltiges Investieren ohne Transparenz nicht funktioniert.
Transparente, faire, nachhaltige und unabhängige Finanzberatung seit 1998