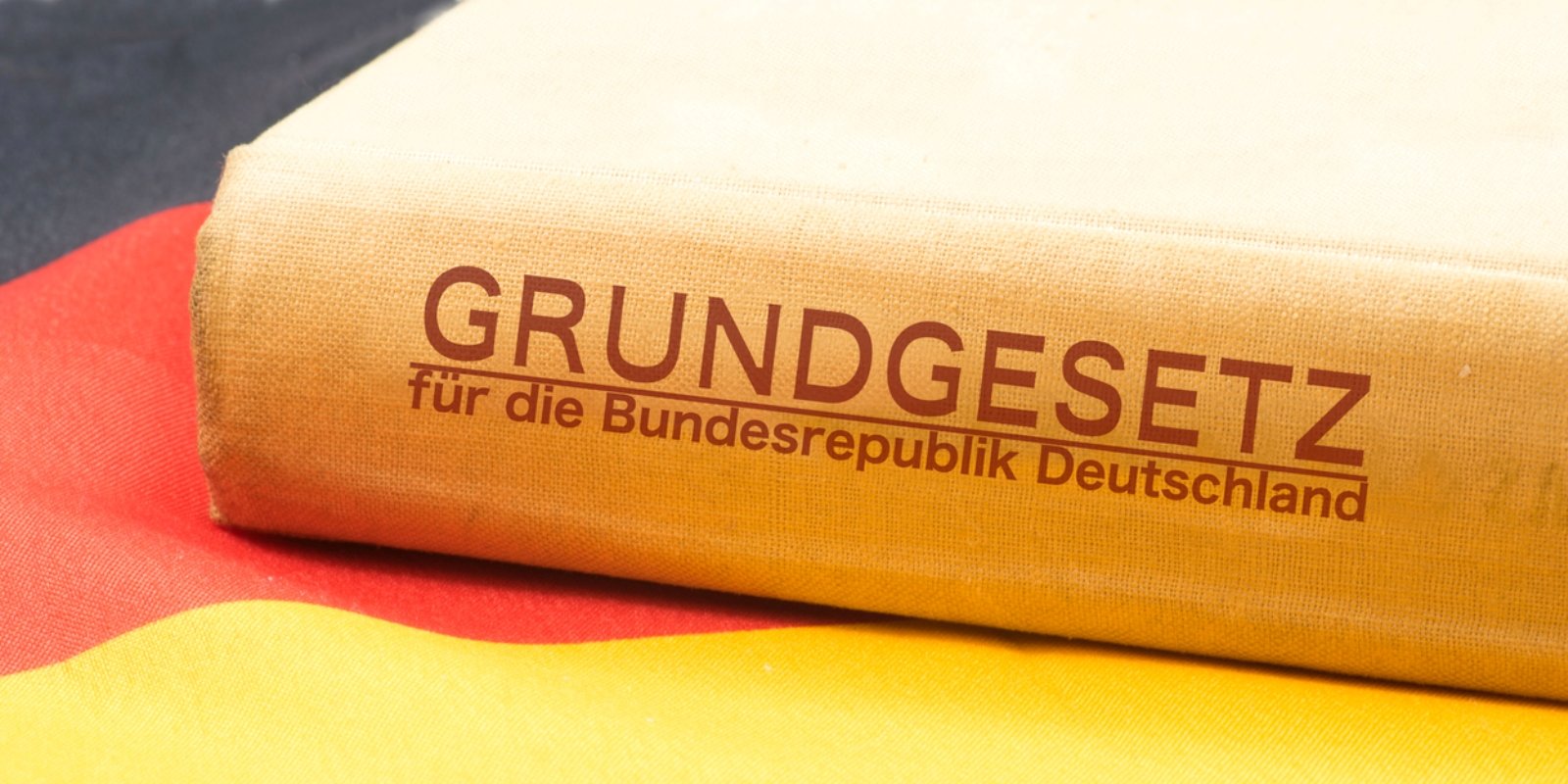Deutsche Bank will Rüstungsgeschäft massiv ausbauen Neue strategische Ausrichtung
Die Deutsche Bank steht vor einer markanten Neuausrichtung ihrer Geschäftspolitik im Bereich der Verteidigungsindustrie. Laut Aussagen von Fabrizio Campelli, Leiter des Unternehmens- und Investmentbankings, hat das Institut „umfassende strukturelle und personelle Maßnahmen“ ergriffen, um ihre Rolle im Verteidigungssektor deutlich zu stärken. Damit vollzieht Deutschlands größtes Geldhaus eine strategische Kehrtwende, die noch vor wenigen Jahren undenkbar erschien – nicht zuletzt angesichts der gesellschaftlichen Debatten um ethische Standards in der Finanzbranche.
Campelli begründet den Kurswechsel mit den „veränderten geopolitischen Rahmenbedingungen“ und verweist dabei nicht nur auf den Krieg in der Ukraine, sondern auch auf die zunehmend instabile Sicherheitslage weltweit. Der Druck auf westliche Staaten, ihre Verteidigungsfähigkeit auszubauen, sei massiv gestiegen – und mit ihm auch der Finanzierungsbedarf der entsprechenden Industrien.
Interne Umstrukturierungen und Personalaufbau
Kernstück der neuen Rüstungsstrategie ist der Aufbau eines dedizierten Teams von Experten für den Verteidigungs- und Sicherheitssektor. Dieses Team operiert unter dem Dach des Investmentbankings und soll sowohl bestehende als auch potenzielle Kunden aus der Verteidigungsindustrie umfassend betreuen – von der klassischen Unternehmensfinanzierung über Kapitalmarkttransaktionen bis hin zu komplexen Fusionen und Übernahmen (M&A).
Laut Bankkreisen wurden gezielt Fachleute mit militärischem und sicherheitspolitischem Hintergrund eingestellt, um die Expertise im Haus substanziell zu erweitern. Man wolle „nicht nur als Finanzierer auftreten, sondern als strategischer Partner“, so Campelli. Damit zielt die Bank auf eine tiefere Integration in die strategischen Entwicklungsprozesse der Verteidigungsunternehmen ab – ein Ansatz, der nicht zuletzt auf die Konkurrenzfähigkeit gegenüber angloamerikanischen Investmenthäusern wie JPMorgan oder Goldman Sachs abzielt, die traditionell stark in diesem Sektor vertreten sind.
Wachsender Markt mit politischem Rückenwind
box
Der Zeitpunkt für diesen Ausbau ist aus Sicht der Bank günstig. Seit Beginn des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine im Jahr 2022 ist ein radikales Umdenken in der europäischen Verteidigungspolitik zu beobachten. Deutschland selbst hat mit dem sogenannten „Sondervermögen Bundeswehr“ in Höhe von 100 Milliarden Euro einen historischen Investitionsschub ausgelöst. Hinzu kommen steigende Verteidigungsbudgets in vielen NATO-Staaten, einhergehend mit der politischen Forderung nach sicherheitspolitischer Souveränität Europas.
Die Verteidigungsindustrie erlebt seither eine nie dagewesene Nachfragewelle – sowohl auf Seiten der Auftraggeber als auch auf den Kapitalmärkten. Viele Unternehmen im Rüstungssektor benötigen Finanzierungsmöglichkeiten für Kapazitätserweiterungen, Innovationsprojekte oder internationale Expansion. Gleichzeitig suchen institutionelle Investoren zunehmend nach Anlagemöglichkeiten, die vom sicherheitspolitischen Paradigmenwechsel profitieren.
Campelli spricht in diesem Zusammenhang von einem „strukturellen Wachstumspfad“ der Branche, den es zu begleiten gelte. Die Deutsche Bank wolle nicht nur ein reaktiver Akteur sein, sondern diesen Pfad aktiv mitgestalten.
Abkehr von früheren ESG-Zurückhaltungen?
Mit dem gezielten Ausbau ihres Rüstungsgeschäfts stellt sich die Deutsche Bank strategisch neu auf – und positioniert sich als bedeutender Akteur in einem Sektor, der in den kommenden Jahren erheblich an wirtschaftlicher und politischer Relevanz gewinnen dürfte. Die Initiative von Fabrizio Campelli und seinem Team ist Ausdruck eines neuen Selbstverständnisses: Die Bank will nicht nur auf Marktbewegungen reagieren, sondern selbst mitgestalten – auch dort, wo früher Zurückhaltung dominierte."
Der Einstieg der Deutschen Bank in das Geschäft mit der Rüstungsindustrie markiert auch eine gewisse Abkehr von früheren Bedenken im Kontext der ESG-Strategien (Environmental, Social, Governance). In den vergangenen Jahren war der Verteidigungssektor in vielen ESG-Ratings problematisch bewertet worden, was Banken und Investoren gleichermaßen zu einer gewissen Zurückhaltung veranlasste. Doch dieses Bild scheint sich nun zu wandeln.
Einige Analysten sprechen sogar von einem „Reframing“ der ESG-Kriterien, insbesondere was das „S“ – also den sozialen Aspekt – betrifft. Verteidigung wird vermehrt als Grundvoraussetzung für Frieden, Stabilität und Menschenrechte verstanden. Auch innerhalb der EU-Kommission gibt es Bemühungen, bestimmte militärische Projekte von bisherigen Ausschlusskriterien auszunehmen.
Die Deutsche Bank folgt diesem Trend offenbar gezielt:
- Sie entwickelt neue interne Bewertungsmaßstäbe für Rüstungsprojekte unter ESG-Aspekten.
- Sie baut ihre Kommunikation gegenüber institutionellen Investoren in Bezug auf ethisch vertretbare Verteidigungsfinanzierungen aus.
- Sie beteiligt sich an Branchendialogen über die künftige Rolle des Finanzsektors in Fragen der Sicherheitspolitik.
Campelli betont, dass „Verteidigung kein Widerspruch zu verantwortungsvollem Banking“ sein müsse – vielmehr sei Sicherheit die Voraussetzung für nachhaltiges Wirtschaften.
Ein riskanter Spagat?
Gleichwohl bleibt der Schritt nicht ohne Risiken. Kritiker werfen der Bank vor, sich zu sehr an geopolitische Opportunitäten anzupassen und ethische Standards zu verwässern. Insbesondere in der deutschen Öffentlichkeit, die traditionell skeptisch gegenüber Rüstungsinvestitionen ist, könnte dieser Strategiewechsel für Kontroversen sorgen.
Auch reputationsseitig begibt sich die Bank auf ein sensibles Terrain. Der Grat zwischen legitimer Sicherheitsfinanzierung und dem Vorwurf, „am Krieg zu verdienen“, ist schmal – und wird nicht zuletzt durch mediale Berichterstattung sowie NGO-Kampagnen regelmäßig beschritten.
Hinzu kommt ein nicht zu unterschätzender finanzieller Aspekt: Rüstungsprojekte sind oft langfristig, technologisch komplex und politisch stark reguliert. Sie bergen daher operative Risiken, die gut kalkuliert sein wollen. Die Deutsche Bank betritt hier ein Feld, das tiefes Verständnis für geopolitische Dynamiken und nationale Sicherheitsstrategien erfordert – ein Kompetenzbereich, den sich das neue Team nun erst erarbeiten muss.
Fazit: Finanzkraft trifft sicherheitspolitische Realität
Mit dem gezielten Ausbau ihres Rüstungsgeschäfts stellt sich die Deutsche Bank strategisch neu auf – und positioniert sich als bedeutender Akteur in einem Sektor, der in den kommenden Jahren erheblich an wirtschaftlicher und politischer Relevanz gewinnen dürfte. Die Initiative von Fabrizio Campelli und seinem Team ist Ausdruck eines neuen Selbstverständnisses: Die Bank will nicht nur auf Marktbewegungen reagieren, sondern selbst mitgestalten – auch dort, wo früher Zurückhaltung dominierte.
Ob dieses Engagement langfristig Früchte trägt, wird nicht nur von der geopolitischen Entwicklung, sondern auch vom gesellschaftlichen Diskurs über die Rolle von Banken in sicherheitsrelevanten Bereichen abhängen. Die Deutsche Bank jedenfalls hat sich entschieden: Sie will ein aktiver Player im neuen sicherheitspolitischen Zeitalter sein.

Ich glaube, dass die Zusammenarbeit mit motivierten Menschen auf beiden Seiten zusätzliche Energie freisetzt