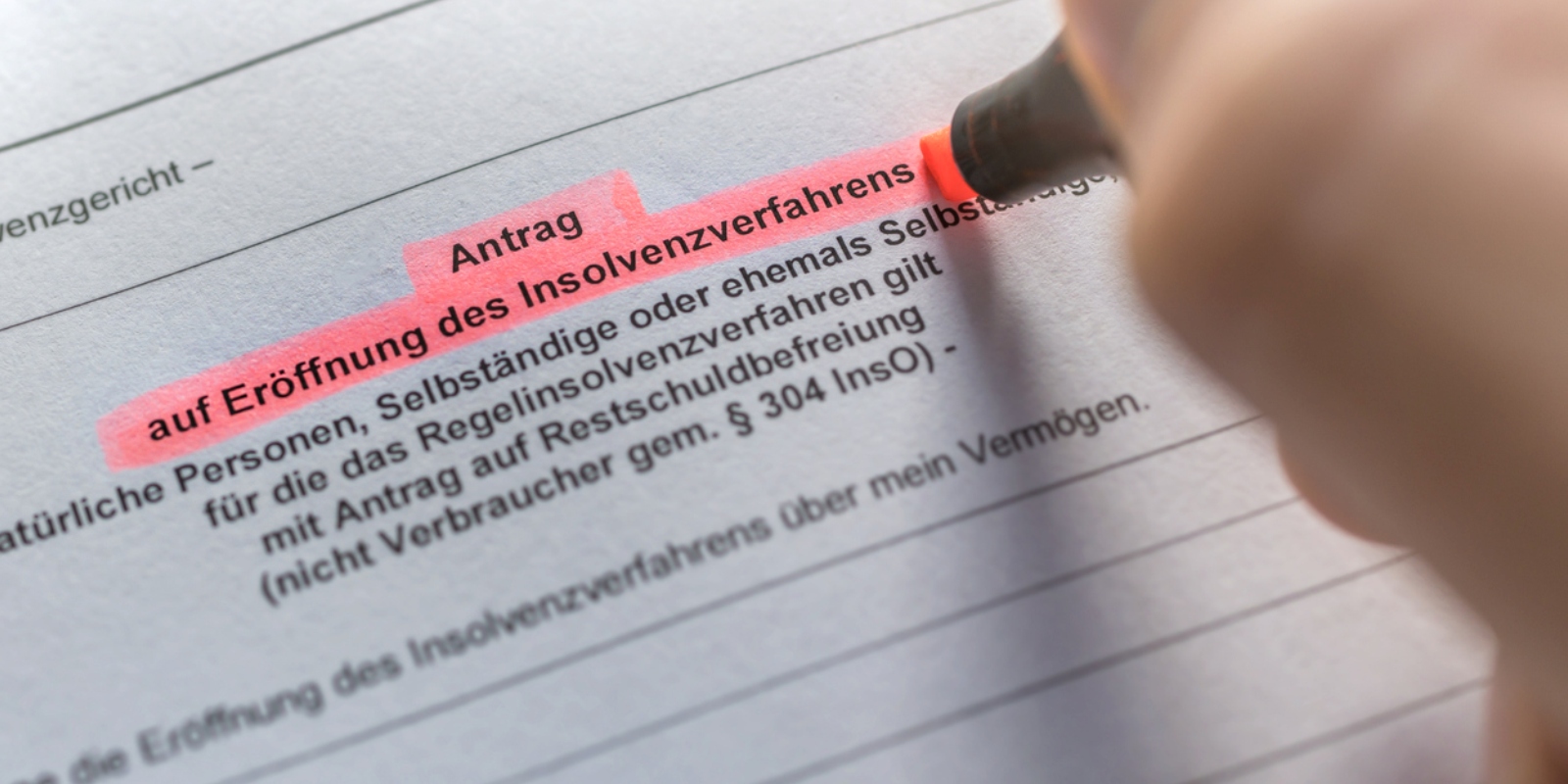Finanzlexikon Ein historischer Renditevergleich
Aktien, Anleihen, Immobilien.
Die Frage nach der „besten“ Anlageform begleitet Anleger seit Generationen. Aktien, Anleihen und Immobilien sind dabei die drei Säulen, auf denen die meisten Vermögensportfolios beruhen. Doch ihre Erträge unterscheiden sich deutlich – je nach Zeitraum, Region und ökonomischem Umfeld. Wer verstehen will, wie Vermögensaufbau funktioniert, muss den historischen Rückblick wagen. Denn erst dieser zeigt, welche Anlageformen wirklich Wohlstand geschaffen haben und wo die Grenzen liegen.
Aktien – langfristiger Renditemeister mit kurzen Schwächen
box
Aktien sind Anteile an Unternehmen – und spiegeln damit direkt die Produktivität und das Wachstum einer Volkswirtschaft wider. Genau deshalb schneiden sie langfristig am besten ab.
- Laut UBS Global Investment Returns Yearbook 2024 erzielten US-Aktien seit 1900 eine reale Durchschnittsrendite von 6,5 % pro Jahr, weltweit lag der Schnitt bei 5,1 %, in Deutschland bei 3,2 %.
- Warum Deutschland schwächer? Kriege, Hyperinflation und Währungsreformen haben die Langfristkurven mehrfach durchbrochen. Wer aber nach dem Zweiten Weltkrieg investierte, konnte auch hierzulande ein respektables Vermögen aufbauen.
Kurzfristig jedoch sind Aktien riskant. Die Finanzkrise 2008 brachte US-Anlegern Verluste von rund 37 %, auch die Corona-Panik 2020 ließ Kurse um über 30 % einbrechen. Doch die Geschichte zeigt: Nach jedem Einbruch folgte eine Erholung, oft schneller und stärker als erwartet.
Die jüngste Entwicklung bestätigt das Bild: 2023 legte der S&P 500 um 24 % zu, 2024 um weitere 23 %. Wer investiert blieb, konnte sein Vermögen in nur zwei Jahren nahezu verdoppeln. Hier zeigt sich die Macht der Märkte: Krisen wirken bedrohlich, doch der Aufschwung dominiert das lange Bild.
Anleihen – das Versprechen von Sicherheit
Anleihen stehen für Sicherheit, Planbarkeit und regelmäßige Zinsen. Wer Staats- oder Unternehmensanleihen hält, weiß genau, wann er sein Kapital zurückerhält – solange der Schuldner zahlungsfähig bleibt.
Historisch betrachtet ist der Ertrag aber ernüchternd. Laut UBS Yearbook lagen die realen Renditen globaler Anleihen seit 1900 bei nur 1,8 %. Nominal schienen die Zinsen oft attraktiv, doch hohe Inflationsphasen – etwa in den 1970er-Jahren – haben die realen Erträge aufgezehrt.
In Deutschland war die Situation besonders paradox: Während Bundesanleihen jahrzehntelang als „sichere Anlage“ galten, vernichteten sie real über weite Strecken Kaufkraft. In den Jahren 2010 bis 2020 lagen die Renditen zeitweise sogar unter null. Wer damals Anleihen hielt, sicherte sein Geld nur scheinbar.
Erst die Zinswende der EZB brachte eine Wende: Die Umlaufrendite deutscher Anleihen lag 2023 bei 2,0 %, 2024 bei 2,3 %, aktuell um die 2,7 %. Real – nach Abzug der Inflation – bleiben die Zuwächse jedoch mager. Anleihen sind also wichtig zur Stabilität, aber keine Wachstumsquelle.
Immobilien – greifbarer Besitz und Inflationsschutz
Wer Vermögen aufbauen will, braucht den langen Atem für Aktien. Wer Sicherheit sucht, mischt Anleihen und Immobilien bei. Die Balance entscheidet, nicht die absolute Wahl einer einzigen Anlageklasse."
Immobilien unterscheiden sich von Aktien und Anleihen: Sie sind nicht nur Anlage, sondern auch Konsumgut. Das Eigenheim bietet Wohnsicherheit, Mietimmobilien regelmäßige Einnahmen.
Historisch lagen die nominalen Renditen von Immobilien bei etwa 4–6 % pro Jahr. Das klingt solide, liegt aber im internationalen Vergleich klar hinter Aktien. Dafür punkten Immobilien in Krisenzeiten: Sie sind weniger volatil, schwerer zu entwerten und dienen als Inflationsschutz.
Allerdings hängt der Erfolg stark von Lage und Zeitpunkt ab. Während Immobilien in München, Hamburg oder Frankfurt seit 2000 enorme Wertzuwächse verzeichneten, stagnieren viele ländliche Regionen. Zudem verschlechtern steigende Zinsen die Finanzierbarkeit: 2023/2024 sah sich Deutschland mit einer abrupten Abkühlung am Immobilienmarkt konfrontiert. Käufer hielten sich zurück, Preise gaben nach – ein klarer Beleg dafür, dass Immobilien keineswegs ein Selbstläufer sind.
Psychologie und Anlegerverhalten
Bemerkenswert ist, dass die Wahrnehmung der Anlageklassen oft im Widerspruch zu den Fakten steht. In Deutschland bevorzugen viele Anleger Immobilien oder Sparbücher, weil sie „sicher“ erscheinen – obwohl die Rendite langfristig gering ist. Aktien dagegen gelten als riskant, obwohl sie nachweislich den größten Vermögensaufbau ermöglichen.
Dieser psychologische Unterschied erklärt, warum die Aktienquote deutscher Privatanleger trotz Rekordrenditen niedrig bleibt. Es ist weniger eine Frage der Mathematik, sondern des Vertrauens in ein abstraktes Papiervermögen. Immobilien wirken greifbarer, auch wenn die nackten Zahlen sie ins Mittelfeld verweisen.
Fazit – drei Klassen, drei Rollen
Der historische Rückblick lässt keine Zweifel:
- Aktien sind die renditestärkste Anlageklasse. Sie erfordern Risikobereitschaft, belohnen aber mit dem größten Vermögenszuwachs.
- Anleihen stabilisieren Portfolios, schützen vor Totalverlust, liefern aber real nur mäßige Erträge.
- Immobilien bieten Stabilität, Inflationsschutz und Nutzwert, doch ihre Rendite hängt stark von Lage und Marktumfeld ab.
Für Anleger bedeutet das: Wer Vermögen aufbauen will, braucht den langen Atem für Aktien. Wer Sicherheit sucht, mischt Anleihen und Immobilien bei. Die Balance entscheidet, nicht die absolute Wahl einer einzigen Anlageklasse.
Erst der Mensch, dann das Geschäft