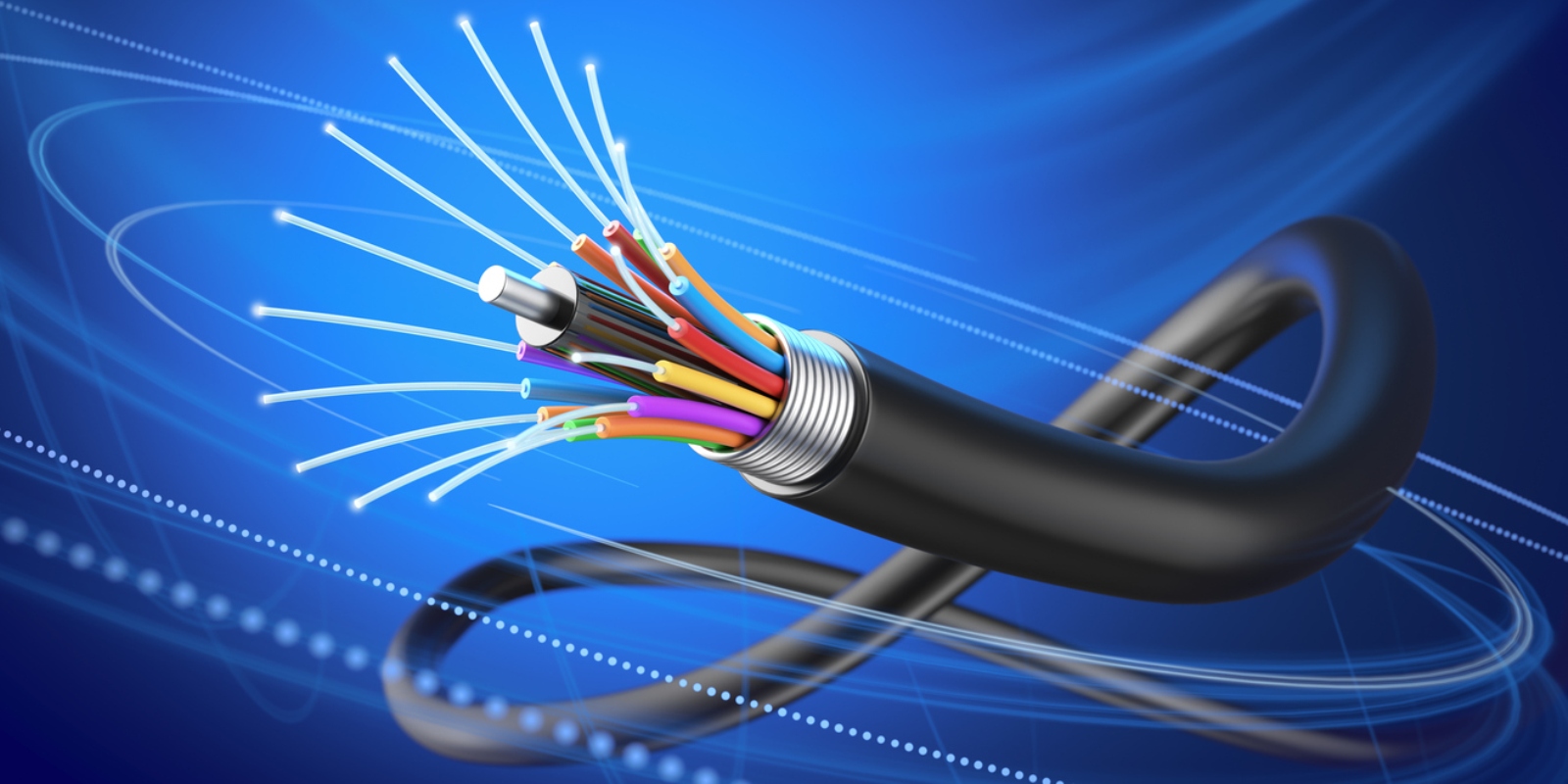Schnelles Internet Kein Glasfaser-Anschluss
Deutschland hat den Übergang von Kupfer zu Glasfaser zu lange als „nice to have“ behandelt. Tatsächlich ist FTTH eine Pflichtaufgabe für Wettbewerbsfähigkeit, Bildung und Lebensqualität.
Streaming, Homeoffice, Cloud-Dienste: Unser Alltag wandert ins Netz. Doch ausgerechnet im Industrieland Deutschland dominiert noch immer Kupfer – also VDSL/Vectoring aus der Telefon-Ära – während echte Glasfaser bis in die Wohnung (FTTH) vielerorts fehlt. Die Technik ist keine Überraschung, sie liegt seit Jahren auf dem Tisch. Warum dauert der flächendeckende Ausbau so lange – und was bedeutet das für Haushalte, Unternehmen und die Wettbewerbsfähigkeit?
Kupfer ist da – Glasfaser kostet
Kupferleitungen liegen bereits in fast jedem Haus. Betreiber können mit überschaubaren Investitionen mehr Tempo herausholen (Vectoring, Super-Vectoring), ohne Straßen aufzureißen. Glasfaser dagegen verlangt Tiefbau, Genehmigungen, Hausanschlüsse und neue Inhaus-Verkabelung. Das ist kapitalintensiv und lohnt sich erst, wenn genug Kundinnen und Kunden tatsächlich einen Glasfaser-Tarif buchen. Solange ein großer Teil auf „gut genug“-Kupfer bleibt, zögert der Business Case.
Die fünf größten Bremsklötze – klar benannt
box
- Genehmigungen & Planung: Tiefbau braucht Zustimmungen: Gemeinde, Straßenverkehr, Denkmalschutz, Leitungspläne. Unterschiedliche Verfahren kosten Zeit. Wer in mehreren Kommunen ausbaut, jongliert mit Papierbergen statt mit Baggern.
- Baukapazitäten & Fachkräfte: Es mangelt an Kolonnen, Maschinenführern, Glasfaser-Spleißern. Selbst wenn das Geld bereitsteht, sind Teams der Engpass. Material ist seltener das Problem als Menschen und Termine.
- Wirtschaftlichkeit im Streubesiedelten: In der Stadt verteilt sich die Trasse auf viele Haushalte. Auf dem Land entstehen pro Anschluss schnell mehrere Tausend Euro Kosten. Ohne Zuschüsse oder gemeinsames Vorgehen bleibt der Ausbau dort schleppend.
- Haus- und Wohnungseigentum: Der Netzbetreiber darf bis zur Grundstücksgrenze. Ab da wird es juristisch und praktisch: Zustimmung der Eigentümergemeinschaft, Leitungswege, Bohrungen, Keller- und Wohnungsverkabelung. Eine Gegenstimme kann Monate kosten.
- Technik-Wording & Übergangslösungen: Viele können FTTC (Glasfaser bis zum Bordstein, dann Kupfer) und FTTH (bis in die Wohnung) nicht sauber unterscheiden. Wer mit VDSL „gerade so“ auskommt, meldet keine Nachfrage – und bremst damit den Ausbau vor Ort.
Wettbewerb hilft – aber nicht immer
Mehrere Anbieter treiben Glasfaser: ehemalige Monopolisten, Stadtwerke-Joint-Ventures, Finanzinvestoren, Regionalplayer. Wettbewerb kann Tempo machen, führt aber in Städten zu Doppeltrassen, während Nachbarviertel leer ausgehen. Das bindet Kapazitäten, die in „grauen Flecken“ fehlen. Besser wird es, wenn Kommunen Gebietsabstimmungen moderieren und Betreiber Kooperationsmodelle (Open Access) nutzen: Eine baut, mehrere vermarkten.
Fördern, aber richtig
Förderprogramme sind sinnvoll, wenn sie gezielt ländliche Regionen adressieren. Unpräzise Förderung hingegen verleiht Anreize, in halb versorgten Gebieten erneut zu graben statt Lücken zu schließen. Wichtig sind klare Karten (wer hat was, bis wohin?), schlanke Vergaben und digitale Antragswege. Jede zusätzliche Formularrunde verlängert Projekte um Monate und verteuert den Anschluss – am Ende zahlen es Steuerzahler und Kunden.
Warum Glasfaser mehr ist als „schnelleres Netflix“
- Produktivität: Mittelständler laden große Dateien, sichern Backups, nutzen Videokonferenzen ohne Aussetzer.
- Standortfaktor: Für viele Berufe ist guter Anschluss so wichtig wie Bahn- oder Autobahnnähe.
- Bildung & Gesundheit: Lernplattformen, Telemedizin, Heimüberwachung – stabil und latenzarm.
- Wohnwert: Ein Haus mit FTTH ist für Käufer und Mieter attraktiver; die Differenz kann handfest sein.
Kurz: Glasfaser ist Infrastruktur wie Wasser und Strom. Wer zu spät kommt, zahlt nicht nur mit Geduld, sondern auch mit Wettbewerbsnachteilen.
Was Kommunen und Betreiber sofort besser machen können
Deutschland hat den Übergang von Kupfer zu Glasfaser zu lange als „nice to have“ behandelt."
Einheitliche Spielregeln
Digitale Genehmigungsportale, feste Bearbeitungsfristen, Standard-Leitungsrechte. Wenn jedes Rathaus anders arbeitet, staut es sich.
Bau effizienter organisieren
Mikro-Trenching und oberflächennahe Verlegung sparen Zeit, wo es die Straße erlaubt. Sammelprojekte bündeln Straßenabschnitte und vermeiden „Dauerbaustellen“.
Open-Access-Verträge
Ein Netz, mehrere Anbieter. So steigt die Auslastung, und die Wirtschaftlichkeit verbessert sich auch in dünneren Gebieten.
Transparente Nachfragebündelung
Wenn 40–50 % eines Viertels vorab bestellen, steht der Bagger schneller bereit. Klare Schwellenwerte, verständliche Kommunikation – keine „Kleingedruckt-Fallen“.
Finanzierung: Wer bezahlt die neue Grundversorgung?
Glasfaser ist teuer, aber planbar: Lange Lebensdauer, geringe Störanfälligkeit, niedrige Betriebskosten. Das lockt langfristiges Kapital (Versicherungen, Infrastrukturfonds). Damit Geld fließt, brauchen Investoren Planungssicherheit: einheitliche Regeln, Kooperationspflichten, belastbare Vorverträge. Jede Verzögerung schmälert die Rendite – und am Ende den Ausbau.
Fazit
Deutschland hat den Übergang von Kupfer zu Glasfaser zu lange als „nice to have“ behandelt. Tatsächlich ist FTTH eine Pflichtaufgabe für Wettbewerbsfähigkeit, Bildung und Lebensqualität. Es scheitert nicht an der Technik, sondern an Prozessen, Anreizen und Kapazitäten. Wenn Kommunen Genehmigungen vereinheitlichen, Anbieter kooperieren, Fördergelder gezielt Lücken schließen und Haushalte Nachfrage aktiv signalisieren, kommt Tempo in die Trasse. Dann verschwindet das Kupfer nicht über Nacht, aber Glasfaser wird zur neuen Normalität – bezahlbar, stabil und zukunftsfest.

fair, ehrlich, authentisch - die Grundlage für das Wohl aller Beteiligten