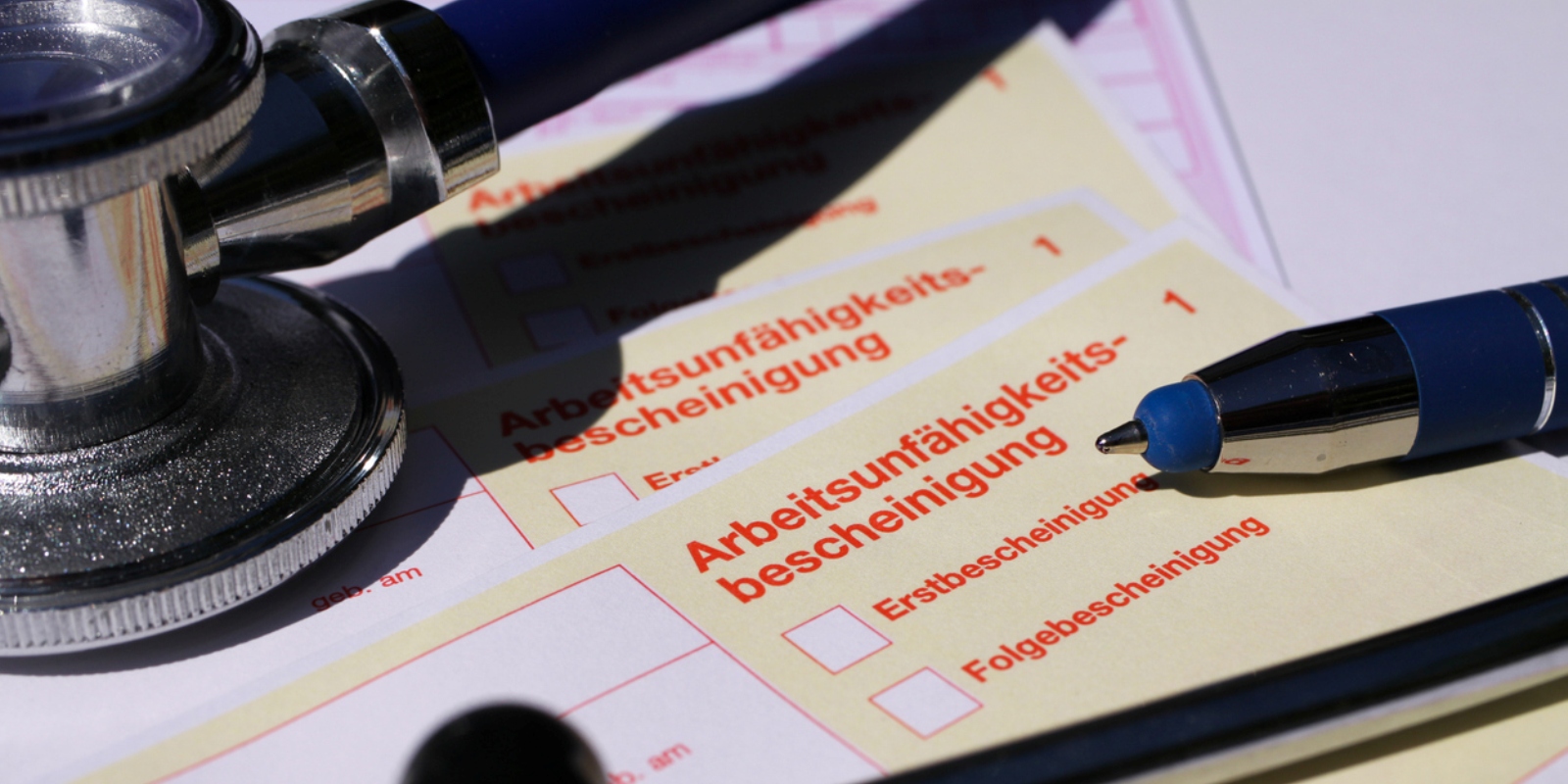Sinns Vorschlag im Stresstest Kein Lohn am ersten Krankheitstag
Fehltage kosten Produktivität und Geld. Die pauschale Nullzahlung am ersten Krankheitstag ist jedoch ein grobes Werkzeug mit erheblichen Nebenwirkungen.
Der Ökonom Hans-Werner Sinn sorgt mit der Forderung für Debatte, Beschäftigte sollten am ersten Krankheitstag keinen Lohn mehr bekommen. Begründung: Deutschland arbeitet zu wenig, die Krankmeldungen seien zu hoch; eine kleine Selbstbeteiligung dämpfe Missbrauch und helfe, die Wirtschaft in der Krise wieder in Schwung zu bringen. Der Vorschlag klingt einfach – ist es aber nicht. Er berührt Arbeitsrecht, Gesundheitsverhalten, Betriebsabläufe und die Frage, wie man Produktivität ohne Kollateralschäden stärkt.
Was heute gilt – und was Sinn ändern will
Nach geltendem Recht haben Arbeitnehmer bei Krankheit Anspruch auf Entgeltfortzahlung durch den Arbeitgeber bis zu sechs Wochen pro Erkrankungsfall, sofern das Arbeitsverhältnis eine gewisse Dauer erreicht hat und die Arbeitsunfähigkeit ordnungsgemäß bescheinigt ist. Sinns Idee zielt nicht auf die sechs Wochen, sondern auf eine Karenz am ersten Tag: keine Lohnzahlung, keine Kompensation – mit der Logik, dass ein minimaler Eigenanteil spontane, zweifelhafte Krankmeldungen unattraktiv mache.
Ökonomische Logik: Anreize, Absentismus, Presenteeism
box
Hinter der Forderung steht ein Anreize-Argument:
Wenn Krankheit am ersten Tag Kosten erzeugt, melden sich Beschäftigte seltener „vorsorglich“ krank.
Das kann kurzfristig Fehltage senken. Doch jede Anreizkorrektur hat Nebenwirkungen:
- Absentismus (unnötiges Fernbleiben) kann sinken.
- Presenteeism (Krank zur Arbeit kommen) kann steigen – mit Produktivitätsverlusten, längeren Krankheitsverläufen und Ansteckungen.
- Verlagerungseffekte: Wer den ersten Tag „durchzieht“, fällt später womöglich länger aus.
Die Nettowirkung hängt von Arbeitsinhalten (Teamkontakt, körperliche Belastung), Betriebskultur und Gesundheitssystem ab.
In Tätigkeiten mit hoher Ansteckungsgefahr kann Presenteeism teurer sein als ein verlorener Tageslohn.
Verteilungseffekte: Wer trägt die Last?
Eine Karenz trifft Beschäftigte asymmetrisch:
- Niedrige Einkommen spüren den Ausfall existenziell; die Verhandlungsmacht für Ausgleichsregeln ist gering.
- Schicht- und Servicejobs mit hoher Exposition (Pflege, Handel, Gastronomie) haben mehr Infektionsrisiko – hier kann Presenteeism die Gesamtausfälle erhöhen.
- Homeoffice-fähige Tätigkeiten können leichter „mit Restgesundheit“ arbeiten oder in Teilzeit umschalten; der Anreiz zur Krankschreibung ist ohnehin geringer.
Ohne Flankierung droht eine regressive Wirkung: Diejenigen, deren Gesundheit am fragilsten ist, zahlen am meisten.
Arbeitgeberperspektive: Planbarkeit vs. Risiko
Aus Unternehmenssicht steht Planbarkeit im Vordergrund. Unklare Kurzfrist-Ausfälle sind teuer. Eine Karenz könnte kurzfristig Signale setzen („Krank nur, wenn nötig“). Gleichzeitig steigen Risiken:
- Infektiöse Präsenz erhöht Ausfälle im Team.
- Image- und Bindungsfragen: Wahrgenommene Härte kann Fachkräfte abschrecken.
- Bürokratie: Abgrenzungen (Teilkrankheit? Arzttermin? Unfall?) und Ausnahmen erzeugen Verwaltungsaufwand.
Betriebe mit guter Prävention (Ergonomie, Schichtplanung, Gesundheitsmanagement) reduzieren Fehltage oft nachhaltiger als mit Strafsignalen.
Arbeitsrechtliche und tarifliche Stellschrauben
Sinns Vorschlag adressiert ein echtes Thema: Fehltage kosten Produktivität und Geld. Die pauschale Nullzahlung am ersten Krankheitstag ist jedoch ein grobes Werkzeug mit erheblichen Nebenwirkungen."
In Deutschland ist die Entgeltfortzahlung gesetzlich verankert; Tarifverträge und Betriebsvereinbarungen verfeinern die Praxis. Eine gesetzliche Karenz wäre ein deutlicher Richtungswechsel. Alternativen innerhalb des bestehenden Rahmens:
- Wartezeit für Lohnfortzahlung nur bei kurzfristigen, wiederholten Ein-Tages-Ausfällen – gekoppelt an ärztliche Atteste ab Tag 1.
- Tarifliche Ausgleichsmechanismen (z. B. Karenztag, aber Kompensation über höheren Grundlohn, Zusatzurlaub oder Gesundheitsbonus).
- Optionale Krankentage (self-certified days) mit klarer Obergrenze pro Jahr und strenger Dokumentation.
Solche Mischmodelle vermeiden Pauschalstrafen und passen Anreize feiner an.
Internationale Blickwinkel: Was lässt sich lernen?
Einige Länder kennen Karenztage (z. B. in Skandinavien zeitweise), meist jedoch eingebettet in starke Sozialpartnerschaft: Karenz wird durch höhere Löhne, Krankengeld ab Tag 2 oder betriebliche Zusatzleistungen abgefedert. Lehre: Karenz funktioniert nur als Paket – alleine verschiebt sie Probleme, anstatt sie zu lösen.
Produktivitätspolitik jenseits der Karenz-Idee
Statt am Symptom „Krankmeldung“ zu operieren, setzen nachhaltige Ansätze am Kausalpfad an:
- Arbeitsorganisation: realistische Schichtpläne, ausreichend Personal, Pausen.
- Prävention: Ergonomie, Impfangebote, Stressreduktion, mentale Gesundheit.
- Digitale Flexibilität: Teil-Remote-Optionen, temporäre Leistungsanpassung bei leichten Erkrankungen.
- Führungsqualität: Ein Klima, in dem frühe Kommunikation vor dem „harten Schnitt“ steht.
Diese Maßnahmen kosten, aber sie senken Ausfälle und Fluktuation messbar – und stärken die Wettbewerbsfähigkeit, ohne soziale Spannungen zu verschärfen.
Politik in der Krise: Symbol oder Struktur?
In konjunkturell schwachen Phasen ist der Ruf nach „klaren Signalen“ beliebt. Eine Karenz am ersten Tag wäre ein solches Signal – sichtbar, aber nicht zwingend wirksam. Strukturreformen mit mehr Arbeitsangebot (Betreuung, Migration, Weiterbildung), Investitionsanreize und Bürokratieabbau wirken breiter auf Produktivität als die Fokussierung auf Fehltagsdisziplin.
Ein Kompromiss, der rechnen kann
Wenn Politik und Sozialpartner dennoch ein Anreiz-Element wollen, spricht viel für ein doppelt flankiertes Modell:
- Karenz light für sehr kurze, häufige Einzelfälle,
- sofortige Kompensation über ein kleines Gesundheitsbudget oder Bonuspunkte im Jahr,
- ärztliche Attestpflicht ab Tag 1 nur bei Häufung,
- klare Ausnahmen für infektiöse Erkrankungen und Pflegeberufe.
So bleibt der Missbrauchsfilter bestehen, ohne die Volksgesundheit zu gefährden.
Fazit
Sinns Vorschlag adressiert ein echtes Thema: Fehltage kosten Produktivität und Geld. Die pauschale Nullzahlung am ersten Krankheitstag ist jedoch ein grobes Werkzeug mit erheblichen Nebenwirkungen: Presenteeism, unfaire Verteilungseffekte und betriebliche Risiken. Wirksamere Wege führen über Arbeitsorganisation, Prävention, Führung und – wenn überhaupt – fein justierte Anreize, die Missbrauch begrenzen, ohne die Gesundheit zur Privatsache zu degradieren. Wer die Wirtschaft dauerhaft stärken will, sollte nicht am ersten Krankheitstag sparen, sondern an den Ursachen der Ausfälle arbeiten.

Ich glaube, dass die Zusammenarbeit mit motivierten Menschen auf beiden Seiten zusätzliche Energie freisetzt