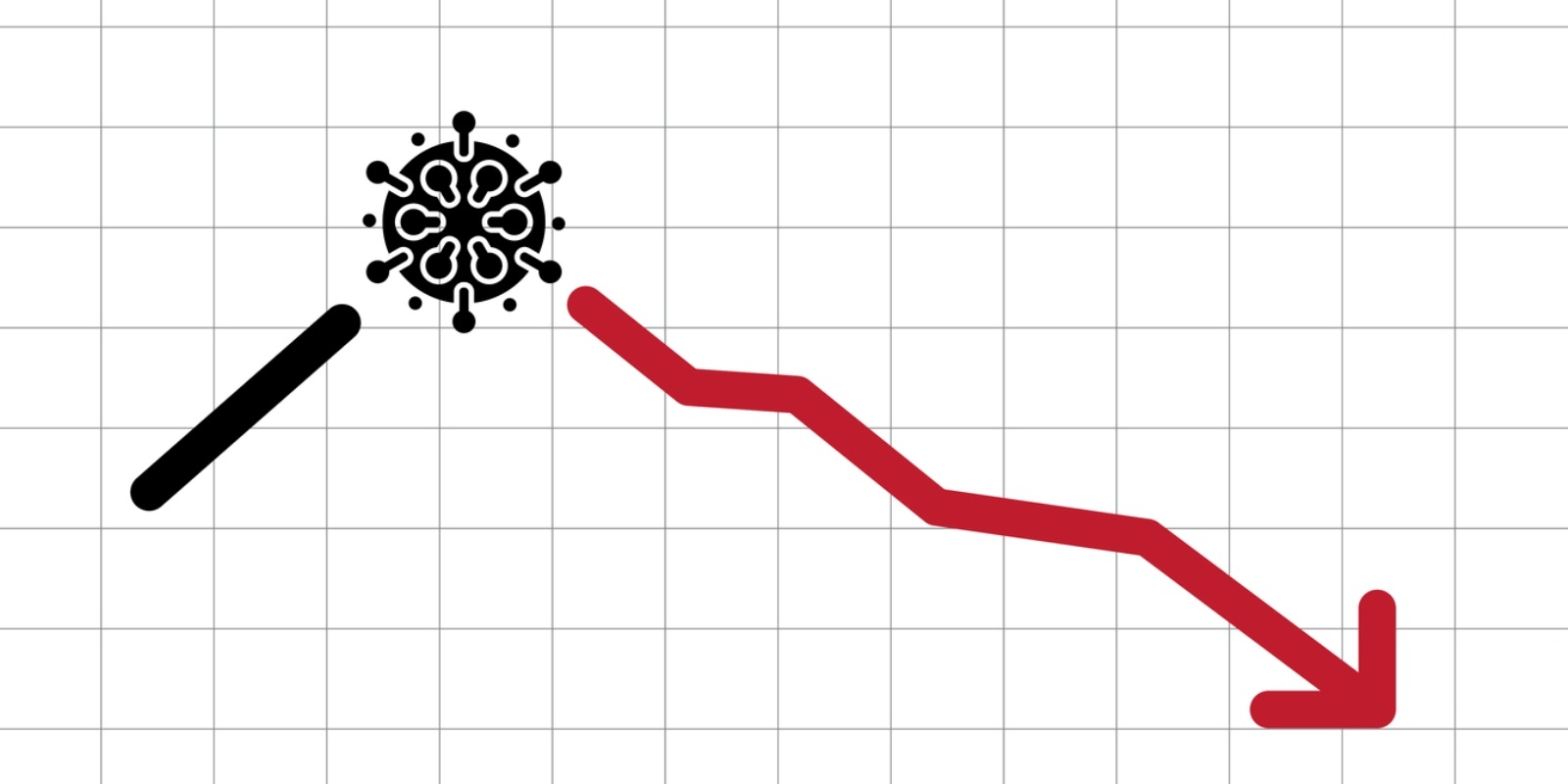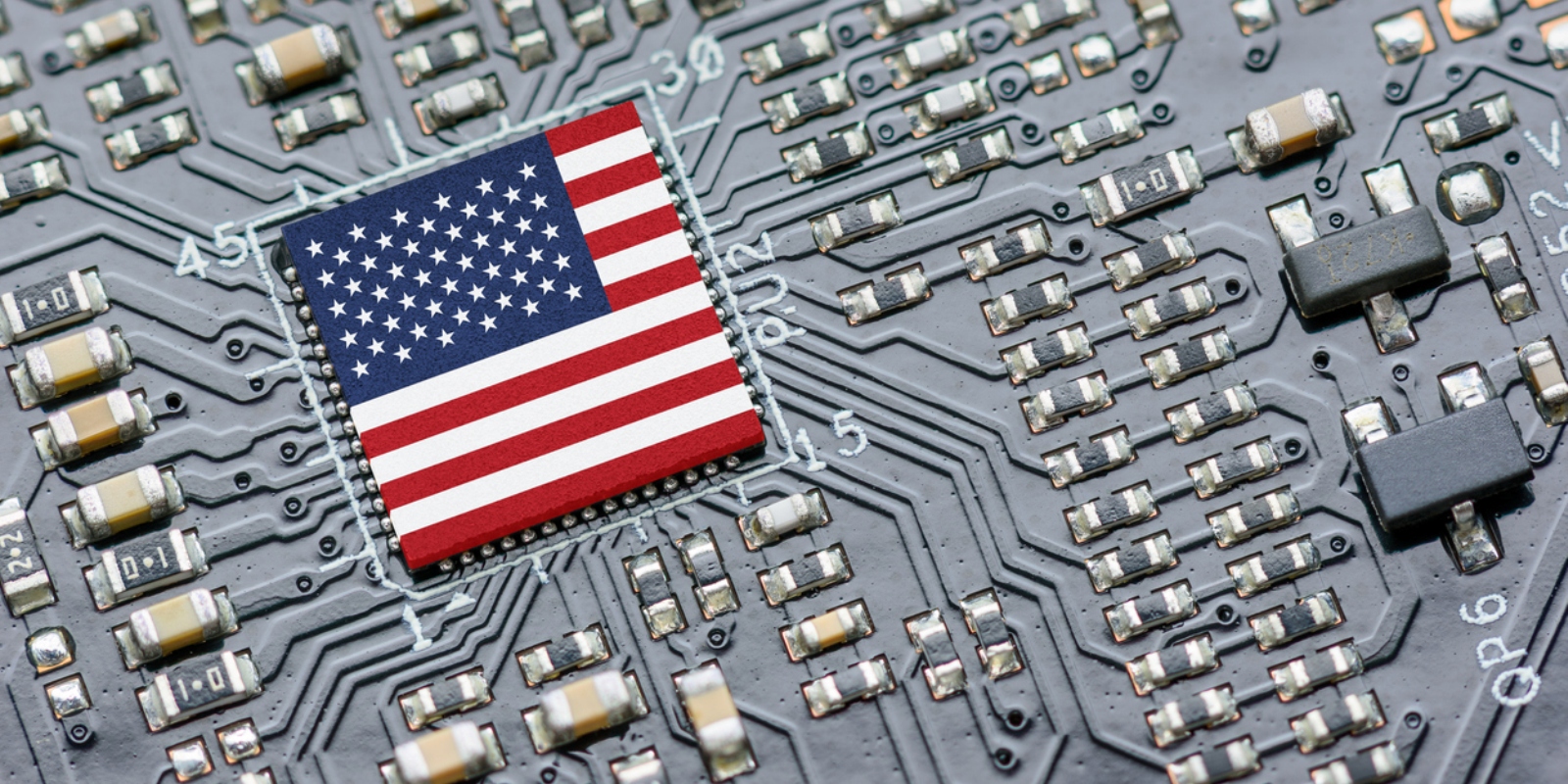Geldpolitische Nebenwirkungen Rückkehr der Negativzinsen
Mit der Rückkehr Donald Trumps auf die weltpolitische Bühne und seiner Ankündigung neuer, umfassender Zölle auf Importe, wird die globale Wirtschaft abermals in einen Zustand erhöhter Unsicherheit versetzt. Die Reaktionen auf seine protektionistische Wirtschaftspolitik lassen nicht lange auf sich warten – nicht nur an den Aktienmärkten, sondern auch in der Geldpolitik.
Besonders bemerkenswert: In mehreren Ländern sinken die kurzfristigen Zinsen erneut, teils bis in den negativen Bereich. Ein besonders auffälliges Beispiel liefert die Schweiz, die bereits in der Vergangenheit mit einem extrem niedrigen Zinsniveau auf globale Krisen reagierte. Nun kehrt das Land – nach einer Phase vorsichtiger geldpolitischer Normalisierung – erneut zu Negativzinsen zurück. Ein Schritt, der sowohl wirtschaftliche als auch politische Dimensionen besitzt und die Debatte über die Rolle der Notenbanken neu entfacht.
Zölle als Katalysator für geldpolitische Lockerung
box
Die neuen Zölle, die Trump mit dem Ziel „fairer Handelsbeziehungen“ verkündet hat, treffen zahlreiche Volkswirtschaften empfindlich.
Sie verteuern nicht nur den internationalen Warenverkehr, sondern wirken auch inflationsdämpfend, da sie Nachfrage und Wachstum bremsen.
Vor allem exportorientierte Länder geraten unter Druck. Unternehmen halten sich mit Investitionen zurück, Konsumenten werden vorsichtiger, Lieferketten müssen umgebaut werden – alles Faktoren, die das Wachstumspotenzial dämpfen und die Notenbanken zum Handeln zwingen.
Die klassische Reaktion auf solche Unsicherheiten: geldpolitische Lockerung.
In Erwartung einer wirtschaftlichen Abkühlung senken die Zentralbanken die kurzfristigen Zinssätze – oder lassen zumindest erkennen, dass sie dazu bereit sind.
Die Märkte preisen diese Entwicklungen schnell ein, wodurch die Renditen am kurzen Ende der Zinskurve fallen – in einigen Fällen sogar wieder unter null.
Schweiz als Vorreiter: Negativzinsen sind zurück
Die Schweizerische Nationalbank (SNB), die sich nach Jahren extremer Zinspolitik erst behutsam aus dem Negativzinsumfeld zurückgezogen hatte, sieht sich nun erneut gezwungen, gegenzusteuern. Aufgrund des neuerlichen Aufwertungsdrucks auf den Schweizer Franken – als sicherer Hafen in unsicheren Zeiten – und der gedämpften wirtschaftlichen Aussichten senkte die SNB jüngst ihren Leitzins wieder unter die Nullmarke.
Damit befinden sich kurzfristige Zinsen in der Schweiz erstmals seit dem Jahr 2022 wieder im negativen Bereich. Ein Schritt, der sowohl Symbolkraft als auch konkrete Wirkung besitzt. Die SNB will damit verhindern, dass der Franken zu stark wird, was die Exportwirtschaft zusätzlich belasten würde.
Auch andere Länder mit starken Währungen oder hoher Abhängigkeit vom Außenhandel – etwa Japan, Dänemark oder einzelne Eurozonenstaaten – beobachten die Lage genau. Einige Marktteilnehmer rechnen mit einer neuen Phase ultraexpansiver Geldpolitik, sollten sich die Handelskonflikte verschärfen.
Was bedeuten Negativzinsen für Anleger und Sparer?
Für Anleger bedeutet das: Die Ära planbarer Zinsen ist weiter in der Ferne. Wer Vermögen erhalten und mehren will, muss flexibel, informiert und diversifiziert agieren. Denn auch wenn Zinsen unter null sinken, bleiben Renditeziele über null eine Notwendigkeit."
Die Rückkehr der Negativzinsen trifft nicht nur Notenbanken und Banken, sondern auch private Haushalte, Unternehmen und institutionelle Investoren. Die Folgen sind vielschichtig:
- Sparer leiden unter realen Verlusten, wenn Guthaben auf Bankkonten keine Zinsen bringen oder sogar Gebühren kosten.
- Renten- und Versicherungsprodukte verlieren an Attraktivität, da sie kaum noch Ertrag abwerfen.
- Immobilien- und Aktienmärkte könnten erneut Auftrieb erhalten, da Anleger gezwungen sind, ins Risiko zu gehen, um Rendite zu erzielen.
- Unternehmen erhalten günstiger Kredite, was Investitionen fördern könnte – sofern das wirtschaftliche Umfeld dies zulässt.
Insbesondere für konservative Anleger stellt sich erneut die Frage: Wie lässt sich Kapital werterhaltend anlegen, wenn sichere Zinsen unter null liegen? Die Suche nach Alternativen – von Dividendenstrategien über Sachwerte bis hin zu strukturierten Produkten – wird wieder intensiver.
Kritik an der Zins-Politik: Ein Teufelskreis?
Mit der Rückkehr der Negativzinsen flammt auch die Kritik an der expansiven Geldpolitik wieder auf. Viele Experten warnen davor, dass dauerhaft niedrige oder negative Zinsen strukturelle Fehlanreize setzen: Sie begünstigen Zombieunternehmen, entwerten Altersvorsorge, destabilisieren Immobilienmärkte und schränken die geldpolitische Handlungsfähigkeit im Krisenfall weiter ein.
Zudem stellt sich die Frage, ob die Zentralbanken mit ihren Instrumenten nicht allmählich an Wirksamkeit verlieren, wenn jede Krise nur noch mit Zinssenkungen beantwortet wird. Einige Stimmen fordern deshalb eine stärkere fiskalpolitische Verantwortung, etwa durch staatliche Investitionsprogramme oder gezielte Subventionen, um Wachstum zu stimulieren.
Fazit: Eine alte Maßnahme in neuem Gewand
Die Rückkehr der Negativzinsen zeigt, dass die Weltwirtschaft noch immer hochgradig anfällig für politische Schocks ist – und dass Zentralbanken sich gezwungen sehen, auch unkonventionelle Maßnahmen erneut einzusetzen.
Was einst als historisch beispiellos galt, gehört offenbar längst zum geldpolitischen Werkzeugkasten. Doch die Frage bleibt: Wie lange lassen sich Märkte und Volkswirtschaften noch auf diese Weise stabilisieren – und zu welchem Preis?

Ich repariere Versicherungsverträge und Finanzdienstleistungen!