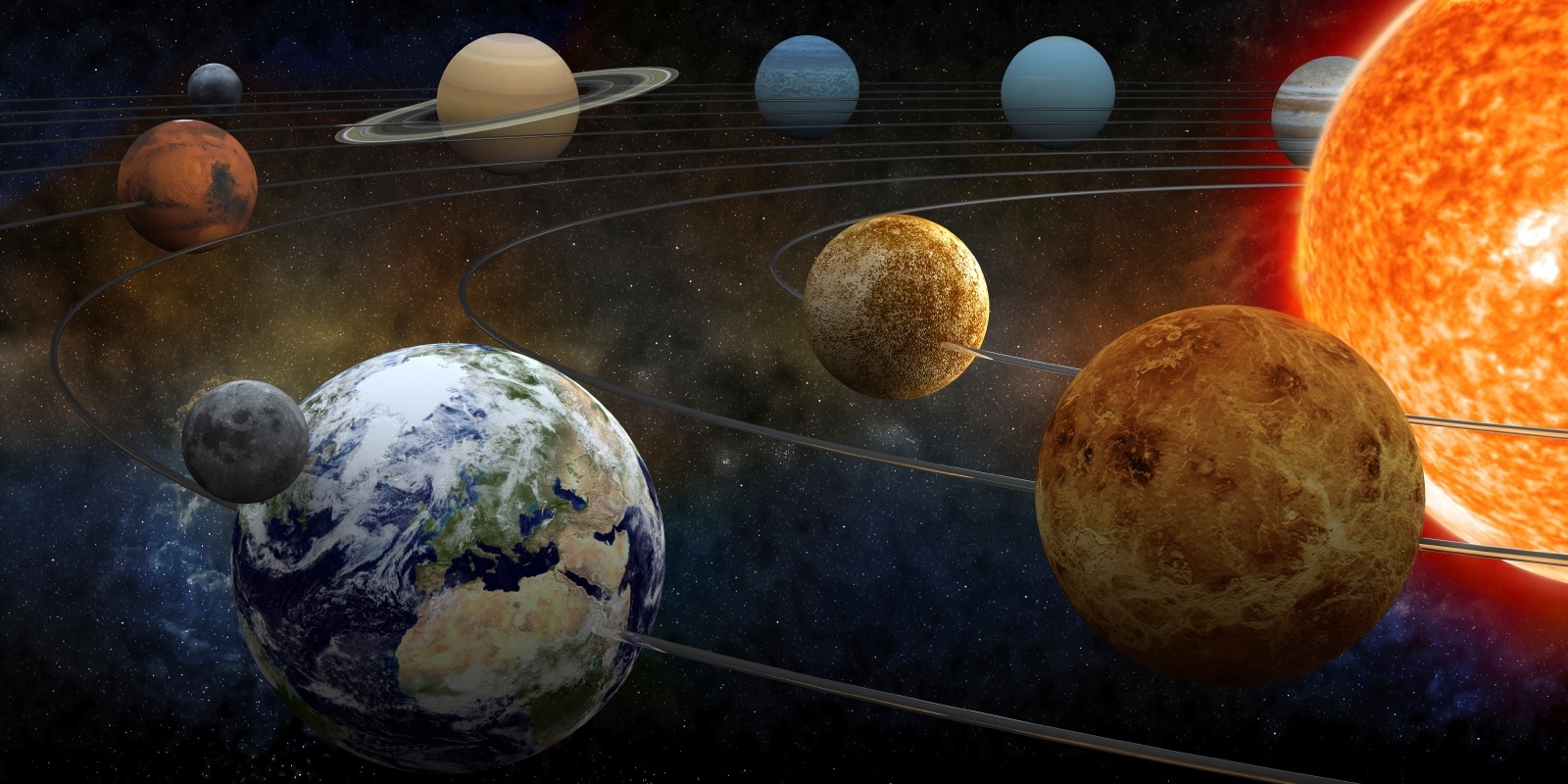Schrecken und Normalität zugleich Die Inflation
Inflation ist beides: Schrecken und Normalität.
Kaum ein wirtschaftliches Phänomen wirkt so direkt und so spürbar auf den Alltag wie Inflation. Wenn Preise steigen, merken es Haushalte beim Einkaufen, Unternehmen bei den Produktionskosten und Sparer auf dem Kontoauszug. Inflation ist deshalb nicht nur eine ökonomische Kennziffer, sondern auch ein gesellschaftliches Reizthema. Für viele ist sie ein Schreckgespenst, das Ersparnisse entwertet und Wohlstand bedroht. Doch der Rückblick zeigt: Inflation ist zugleich ein notwendiger Bestandteil funktionierender Volkswirtschaften – wenn sie im richtigen Maß bleibt.
Was Inflation bedeutet
Inflation beschreibt den Anstieg des allgemeinen Preisniveaus. Das bedeutet: Mit derselben Geldmenge lassen sich im Zeitverlauf weniger Güter und Dienstleistungen kaufen – die Kaufkraft sinkt. Gemessen wird Inflation in der Regel mit Verbraucherpreisindizes, die einen repräsentativen Warenkorb erfassen.
Wichtig ist die Unterscheidung zwischen:
- Moderater Inflation (1–3 % pro Jahr), die für dynamische Volkswirtschaften als normal und gesund gilt.
- Hoher Inflation (über 5–10 %), die Unsicherheit erzeugt, Planung erschwert und Ersparnisse entwertet.
- Hyperinflation, wie in Deutschland 1923, die ganze Währungen zerstört.
Inflation in der Wirtschaftsgeschichte
box
Ein Blick zurück zeigt die unterschiedlichen Gesichter der Inflation:
- Deutschland 1923: Die Hyperinflation nach dem Ersten Weltkrieg ist ein Trauma, das das Vertrauen in Geld bis heute prägt. Preise stiegen so schnell, dass Löhne täglich ausgezahlt wurden, um sie sofort auszugeben.
- Die 1970er-Jahre: Ölkrisen und Lohn-Preis-Spiralen führten in vielen Industrieländern zu zweistelligen Inflationsraten. Anleger litten unter massiven realen Verlusten, die Notenbanken mussten mit drastischen Zinserhöhungen gegensteuern.
- Japan ab den 1990ern: Hier zeigte sich das Gegenteil: extrem niedrige oder gar negative Inflation. Viele hielten sich mit Investitionen zurück, weil sie ständig mit fallenden Preisen rechneten – eine „verlorene Dekade“.
- 2021–2022: Nach der Corona-Pandemie kam es weltweit zu einem Inflationsschub. Lieferkettenprobleme, hohe Energiepreise und eine expansive Geldpolitik führten in Europa zu Raten von über 7 %. Für viele Menschen war dies die erste spürbare Inflationserfahrung ihres Lebens.
Inflation als Normalität
So bedrohlich Inflation wirken kann, in Maßen ist sie notwendig. Eine Wirtschaft ohne Inflation – also mit völliger Preisstabilität oder gar Deflation – würde erstarren. Unternehmen hätten kaum Anreize, zu investieren, wenn sie keine steigenden Preise erwarten könnten. Arbeitnehmer hätten größere Schwierigkeiten, Lohnerhöhungen durchzusetzen.
Deshalb haben Zentralbanken weltweit Inflationsziele von etwa 2 % eingeführt. Diese „stabile Inflation“ gilt als Puffer: hoch genug, um Dynamik zu erzeugen, niedrig genug, um Kaufkraftverluste gering zu halten.
Die Folgen für Anleger
Inflation darf nie unterschätzt werden. Nominale Sicherheit schützt nicht vor realen Verlusten. Wer Vermögen erhalten will, braucht Anlagen, die mit der Inflation Schritt halten können – auch wenn sie auf den ersten Blick riskanter erscheinen."
Inflation ist für Anleger ein entscheidender Faktor – oft sogar wichtiger als Börsenschwankungen.
- Nominalzinsen täuschen: Ein Sparbuchzins von 2 % klingt attraktiv, wenn die Inflation aber 3 % beträgt, verliert der Anleger real 1 %.
- Sachwerte profitieren: Aktien, Immobilien und Rohstoffe haben in der Vergangenheit besser mit Inflation Schritt gehalten als Anleihen oder Bankguthaben.
- Diversifikation wird wichtig: In Inflationsphasen können traditionelle „sichere Häfen“ wie Anleihen real Verluste bringen, während Sachwerte den Schutz liefern.
Die Inflation der Jahre 2021–2022 hat vielen deutschen Sparern erstmals bewusst gemacht, dass „Sicherheit“ auf dem Konto teuer sein kann.
Psychologische Dimension
Inflation ist mehr als Statistik – sie ist gefühlte Realität. Menschen nehmen Preissteigerungen bei Gütern des täglichen Bedarfs, wie Lebensmitteln oder Energie, stärker wahr als bei langlebigen Konsumgütern. So kann die gefühlte Inflation deutlich über den offiziellen Zahlen liegen. Diese Wahrnehmung beeinflusst Erwartungen und damit auch Verhalten: Wer steigende Preise erwartet, kauft vorzeitig, fordert höhere Löhne oder meidet langfristige Sparprodukte.
Gerade in Deutschland ist die Sensibilität besonders ausgeprägt. Historische Erfahrungen haben ein Misstrauen gegenüber Inflation geschaffen, das bis heute Politik und öffentliche Debatten prägt.
Fazit
Inflation ist beides: Schrecken und Normalität.
- Ja, sie bedroht Kaufkraft und kann Wohlstand zerstören, wenn sie außer Kontrolle gerät.
- Aber sie ist auch notwendiger Bestandteil einer dynamischen Wirtschaft. Ohne sie fehlt der Motor für Investitionen, Lohnsteigerungen und Wachstum.
Für Anleger bedeutet das: Inflation darf nie unterschätzt werden. Nominale Sicherheit schützt nicht vor realen Verlusten. Wer Vermögen erhalten will, braucht Anlagen, die mit der Inflation Schritt halten können – auch wenn sie auf den ersten Blick riskanter erscheinen.

Ich glaube, dass Menschen, die sich ihrer Ziele und Werte bewusst werden, sorgenfreier leben.