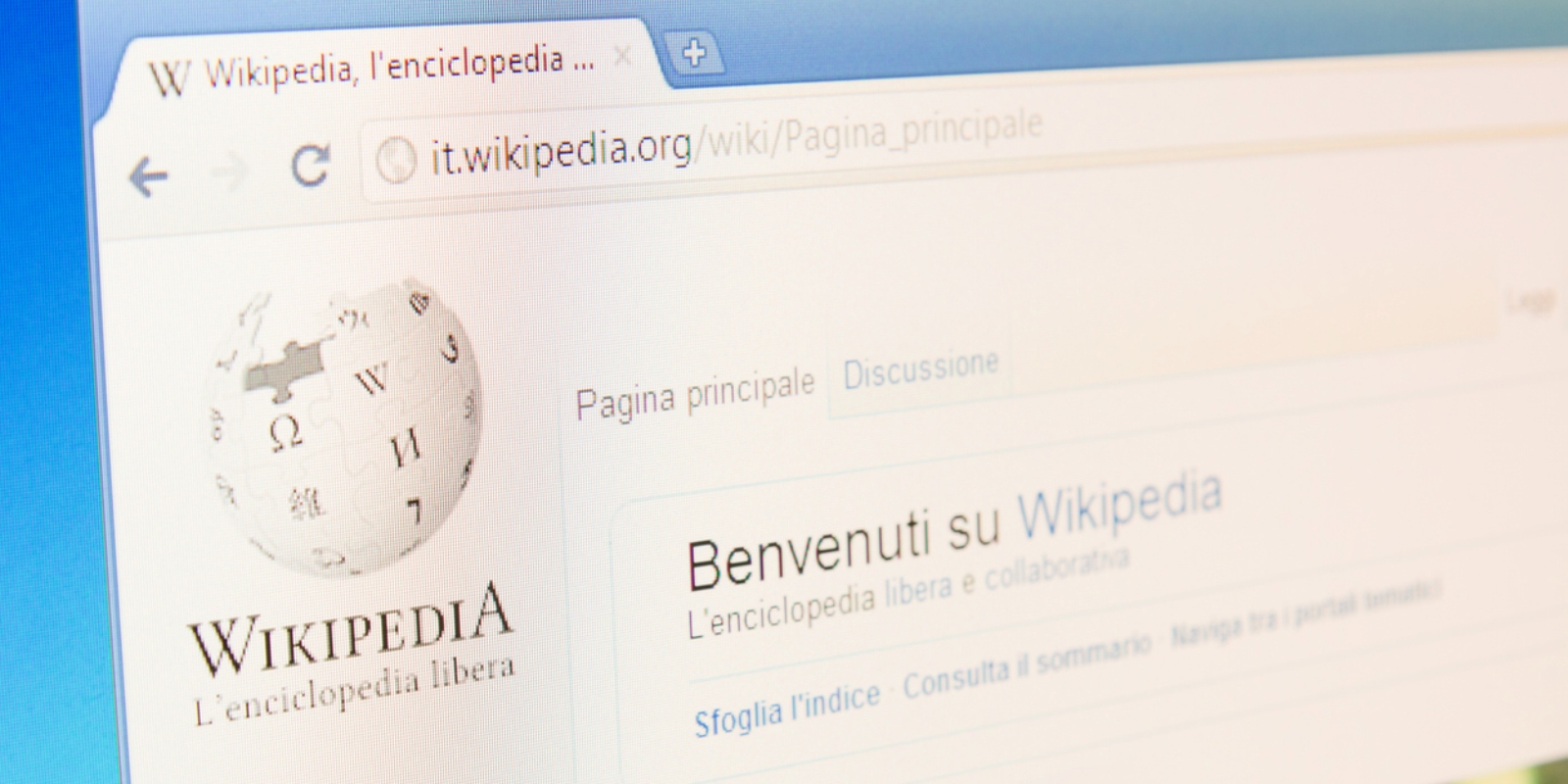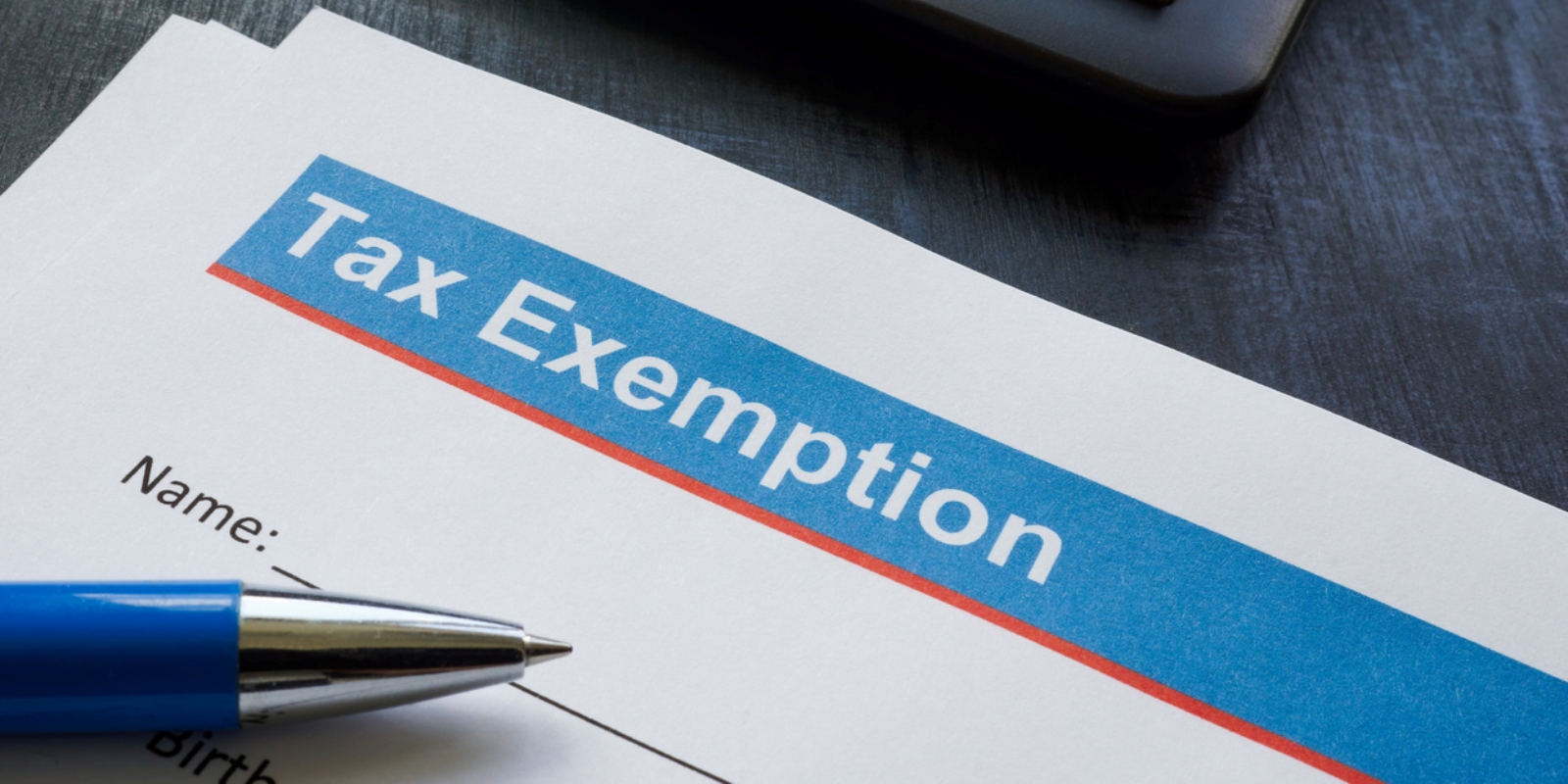Ausscheiden der FDP Ist der Liberalismus gescheitert?
Mit dem der FDP aus Landesparlamenten und dem Bundestag rückt eine Frage ins Zentrum der politischen Debatte, die über parteipolitische Taktik hinausweist: Ist der Liberalismus in Deutschland – in seiner politischen, kulturellen und wirtschaftlichen Ausprägung – gescheitert? Oder steht er lediglich vor der Notwendigkeit einer grundlegenden Erneuerung?
Die klassische freiheitliche Erzählung hat es derzeit schwer. Zwischen einer wachsenden Staatsgläubigkeit auf der einen Seite und einer zunehmenden Marktverachtung auf der anderen scheint für das liberale Denken kaum noch Platz zu sein. Die gesellschaftlichen und politischen Entwicklungen verlangen nach Antworten – aber sie rufen sie nicht mehr von den Liberalen ab.
Zwischen zwei Welten: Der Liberalismus in der Sackgasse
box
Die FDP, über Jahrzehnte hinweg politischer Repräsentant der marktwirtschaftlichen Mitte, leidet derzeit unter einer doppelten Unschärfe.
Einerseits will sie das Erbe der Freiheit hochhalten – gegen Bürokratie, Verbote und staatliche Übergriffigkeit.
Andererseits steht sie unter dem Druck, in Koalitionen mitzugestalten, Kompromisse einzugehen und den Realitätstest zu bestehen.
Doch in einer Zeit, in der große Teile der Gesellschaft Sicherheit, Ordnung und Orientierung einfordern – sei es durch Klimakrise, geopolitische Spannungen oder soziale Verwerfungen – wirkt der Liberalismus oft wie ein überholtes Konzept aus besseren Zeiten.
Wo früher „so viel Staat wie nötig, so wenig wie möglich“ als Orientierung galt, dominiert heute der Ruf nach mehr Eingriff, mehr Schutz, mehr Fürsorge.
Und wo die liberale Hoffnung auf individuelle Verantwortung und wirtschaftliche Selbstentfaltung setzte, überwiegt zunehmend die Skepsis gegenüber Märkten, Kapital und Globalisierung.
Verlust an Erzählkraft – ein intellektuelles Vakuum
Das Problem des heutigen Liberalismus ist weniger seine Substanz als seine fehlende Anschlussfähigkeit. Seine Grundsätze – Eigenverantwortung, Rechtsstaat, Chancengleichheit, Wettbewerb – sind in der Theorie kaum widerlegt. Aber sie erscheinen nicht mehr als Antwort auf die Probleme unserer Zeit.
- Wer in einer Welt multipler Krisen nur auf „weniger Staat“ setzt, wirkt weltfremd.
- Wer Gerechtigkeit rein durch Leistung und Markt erklärt, ignoriert strukturelle Ungleichheiten.
- Wer Freiheitsbegriffe ohne sozialen Kontext verteidigt, klingt elitär – oder abgehoben.
Hinzu kommt, dass die liberale Erzählung heute weniger gegen autoritäre Systeme oder sozialistische Utopien gerichtet ist, sondern gegen eine neue Mischung aus Verantwortungsethik, ökologischer Transformation und progressivem Staatshandeln, die sich gesellschaftlich als tragfähiger erweist.
Der Liberalismus hat dabei keine glaubwürdige Gegenposition formuliert, sondern sich in Verteidigungskämpfen und Abgrenzungsritualen verloren – gegen Klimapolitik, Schuldenpolitik, Identitätspolitik, Umverteilung. Doch reines Dagegen-Sein ist kein Programm.
Liberalismus aus der Zeit heraus denken – nicht gegen sie
Was fehlt, ist ein Liberalismus, der nicht rückwärtsgewandt verteidigt, sondern vorwärtsgewandt gestaltet. Der nicht nur vom Individuum spricht, sondern auch von Solidarität. Der nicht nur den Markt erklärt, sondern auch die Gesellschaft ernst nimmt. Ob er in der FDP noch eine Heimat hat, ist offen. Klar ist nur: Ein demokratisches Gemeinwesen ohne liberale Stimme – das ist ein echtes Risiko. Wer Freiheit bewahren will, muss sie aus der Zeit heraus neu begründen. Sonst bleibt sie nur noch ein Wort – ohne Wirkung."
Die Krise des Liberalismus ist keine Niederlage seiner Prinzipien, sondern eine Krise der politischen Übersetzung. Freiheit ist kein Auslaufmodell – aber sie muss neu erzählt werden, jenseits von Steuerdebatten und Deregulierungsversprechen.
Was fehlt, ist ein Liberalismus, der:
- ökologische Verantwortung als Freiheitsbedingung versteht – nicht als Widerspruch,
- soziale Sicherheit nicht als Belastung, sondern als Ermöglichung individueller Entfaltung begreift,
- Technologie als Instrument zur Stärkung demokratischer Teilhabe und nicht nur als Marktimpuls denkt,
- Bildung nicht nur als Leistungsweg, sondern als Grundlage für Selbstbestimmung verteidigt.
Ein solcher Liberalismus müsste sich von den Reflexen der Vergangenheit lösen und den Mut haben, im Hier und Jetzt wieder Relevanz zu gewinnen – nicht durch Rückzug, sondern durch intellektuelle Offensive.
Partei ohne Boden – und die Gefahr politischer Marginalisierung
Die FDP steht dabei exemplarisch für die Krise. Ihr Ausscheiden aus Parlamenten wäre mehr als ein parteipolitischer Einbruch – es wäre ein Hinweis darauf, dass das freiheitliche Denken in Deutschland keine politische Heimat mehr hat.
Denn bisher ist es keiner anderen Partei gelungen, liberale Positionen glaubwürdig zu integrieren. Die Grünen verbinden Fortschritt mit Staat. Die SPD setzt auf Gerechtigkeit durch Umverteilung. Die CDU sucht Ordnung und Wirtschaftskompetenz – aber nicht Freiheitsgestaltung. Und die AfD missbraucht den Begriff der Freiheit für anti-demokratische Narrative.
Wenn die FDP inhaltlich nicht überlebt – und sich nicht wandelt –, entsteht ein Vakuum, das langfristig gefährlich ist: für die politische Balance, für die Diskurskultur, für die Innovationsfähigkeit einer offenen Gesellschaft.
Fazit: Liberalismus braucht keinen Abgesang – aber eine neue Stimme
Der Liberalismus ist nicht gescheitert. Aber er ist verstummt, veraltet und selbstvergessen. Er hat sich lange auf seiner Geschichte ausgeruht – als Gegner des Totalitarismus, als Architekt der Marktwirtschaft, als Garant bürgerlicher Freiheiten. Doch diese Narrative greifen heute zu kurz.

Ich glaube, dass Menschen, die sich ihrer Ziele und Werte bewusst werden, sorgenfreier leben.